|
SUMMA OF THE FIRST THREE PHASES
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
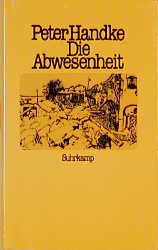
|
Im Abseits; Peter Handke und das Unbehagen des Romans an sich selbst
Der Roman der juengsten Zeit ist ein munteres Kerlchen: Durchtrainiert, unermuedlich und weit gereist, macht er gar nicht den Eindruck, als haette die versammelte Literaturkritik schon einmal an seinem Totenbett gesessen. Er achtet auf seinen Koerper. Er erzaehlt gern von seinen Abenteuern, nicht zuletzt von denen in vergangenen Zeiten. Er wird nicht muede, von den Begegnungen der Geschlechter zu berichten, von den schoenen, den unangenehmen und am liebsten von den ganz obszoenen. Und er scheint gar nicht ungluecklich zu werden, wenn er sich dabei nicht mehr auf der Hoehe seiner handwerklichen, geschweige denn gedanklichen Faehigkeiten befindet. Im Gegenteil: das Selbstgestrickte und Kunstlose, die Geringschaetzung seiner poetischen Mittel und seiner intellektuellen Kraft, ist fester Bestandteil des Pakts, den der Roman mit einem erstaunlich treuen und sogar immer groesser werdenden Publikum geschlossen hat.
Es gibt hierzulande nicht viele, denen der Realismus des zeitgenoessischen Romans, diese scheinbare Mimikry mit dem Leben, sehr unheimlich ist: W. G. Sebald, der vor fast genau einem Jahr ums Leben kam, war so einer. Botho Strauss gehoert dazu, um so mehr, je weiter er sich mit seinem Projekt, das Dasein durch Lektuere zu beschweren, ins Abgelegene der Literaturgeschichte voran arbeitet. Und vor allem ist es Peter Handke, der dem von vielen bunten Adjektiven berauschten Erzaehlen, dem farbenfrohen Auspinseln mehr oder weniger erfundener, stets aber hoch aufregender und tief empfundener Lebenslagen misstraut.
Allen drei gemeinsam ist das Unbehagen des Romanciers an sich selber: Wie verhalte ich mich zur Kunst der Prosa, aus der ich komme, fragt jeder von ihnen auf seine Weise - kann ich meinen Vorgaengern, kann ich Johann Wolfgang Goethe, Joseph de Maistre oder Adalbert Stifter auf gleicher Hoehe in die Augen sehen? Und klingt sie nicht absurd, diese Frage, wirkt sie nicht vermessen, ja auf grausam ueberhebliche Art versponnen? Aber nein, denn es ist umgekehrt: Es ist ignorant, ja toericht, wenn sich ein Dichter nicht an seinen Vorgaengern misst. Denn wenn ueberhaupt ein Beruf eine ungebrochene Tradition hat, dann ist es dieser.
Am heutigen Freitag wird Peter Handke sechzig Jahre alt. Aber dieser Geburtstag ist keiner wie die anderen - und keiner wird diesen Tag begehen wie das Jubilaeum von Altersgenossen wie Alice Schwarzer oder den sechzigsten Geburtstag des seit langer Zeit toten Jimi Hendrix. Denn runde Geburtstage sind Feiern der Gemeinschaft, sie bestaetigen ein Ankunft und sind ein Versprechen fuer die Zukunft. Peter Handke aber wird heute viele Wuerdigungen erhalten und wenige Glueckwuensche. Denn er fuer die meisten gehoert er nicht mehr dazu. Wie kein anderer deutschsprachiger Schriftsteller hat er sich entschlossen ins Abseits geschrieben. Peter Handke ist der prominenteste erfolglose Autor der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
Der Stuttgarter Germanist Heinz Schlaffer hat in der juengsten Ausgabe der Zeitschrift =Sinn und Form= (November/Dezember 2002) einen Aufsatz ueber den Roman als das =letzte Stadium der Literatur= veroeffentlicht. Einst habe Dichtung vorzueglich aus Lyrik und Drama bestanden, erlaeutert er, der Roman sei jung und erst aus der Demokratisierung, ja Banalisierung der Kunst entstanden: =Im klassischen System der Literatur ist die Stellung der Romanprosa doppelt bestimmt: durch den Gegensatz zum Vers und, da der Vers sich hochmuetig von der Alltagssprache abgewandt hatte, durch die Naehe zur Prosa der alltaeglichen, forensischen und wissenschaftlichen Sprache.= Seit mindestens einem Jahrzehnt will Peter Handke hinter diese Trennung zurueck gehen und eine Prosa schreiben, die auf Hoehe der Versdichtung ist, die sich messen kann nicht nur mit den mittelalterlichen Epen, sondern weit darueber hinaus mit der Poesie der Antike. Das Seil, ueber das er seitdem balanciert, haengt hoch, und nicht immer bleibt der Unbeirrbare oben.
Seine letzten wirklich erfolgreichen Buecher waren die schmalen, die Trilogie ueber die Jukebox, die Muedigkeit, den geglueckten Tag, die kleinen Buecher, die zwischen Erzaehlung und Essay changierten. Doch dann kam, im Jahre 1994, =Mein Jahr in der Niemandsbucht=, das Ungetuem, der gewaltige Anlauf zum grossen Roman - ein Buch, das aber gross nicht durch seinen Stoff sein sollte, sondern durch seine Form. Welthaltigkeit in Sprachhaltigkeit zu uebersetzen ist seitdem der Ehrgeiz dieses Dichters - und vielleicht: nachhaltig zu sein. Dieser Absicht gehorcht die entschiedene Trennung der schriftlichen von der muendlichen Sprache, sie verfolgt Peter Handke mit seinen Idealen von Abstand, Reinigung und Ordnung.
Koennte man den modernen Roman mit den Augen noch des neunzehnten Jahrhunderts betrachten, so haette er etwas sehr Frivoles - nichts stellt er lieber aus als die privatesten Verhaeltnisse, eifrig macht er sich gleichrangig mit den Torheiten und Trivialitaeten des taeglichen Lebens, gierig blickt er unter die Waesche. Unter solchen Bedingungen muss einer, der darauf besteht, dass sich die Literatur von der Realitaet entschlossen abzusetzen habe, einer, der die erzaehlende Zeit dehnt, um in einer Art von Daseinsfroemmigkeit =das Vorhandene= zu erwaermen, wie ein anachronistischer Tor wirken - bestenfalls. Aber wer sagt, dass der Dichter zeitgemaess sein muss? Auch in Peter Handkes spaeten Werken, laesst sich ein UEberschuss von Dasein wahrnehmen, den man ohne ihn nicht wahrnaehme. Und Saetze von makelloser Schoenheit kann er immer noch schreiben.
Wenn Peter Handke in den vergangenen Jahren noch eine grosse Aufmerksamkeit auf sich zog, dann als politischer Abenteurer. Diese Wirkung aber beruhte auf einem Missverstaendnis. Denn fuer die politischen Verhaeltnisse in Serbien hat er sich nie fuer zustaendig erklaert. Jugoslawien, der Vielvoelkerstaat - das ist bei Peter Handke ein Kollektivsingular, wie es in seiner Dichtung viele gibt. Die Existenz verdanken diese grossen Namen der Neigung des Dichters zum Allegorischen, und auch diese Neigung gehoert zu dem keineswegs unmodernen Entschluss, in die literarische Vormoderne zurueckzukehren. Das Bunte, das Indiskrete und das Spektakulaere muss nun draussen bleiben, und nichts ist hier so fern wie die moderne Rivalitaet des Romans zum Spielfilm.
Peter Handke, so ist zu erwarten, wird in den kommenden Jahren keine grosse Leserschaft mehr finden. Diesen Verlust wird er vermutlich mit einem Schulterzucken ertragen. In seinen Romanen geht es ohnehin zu wie in einem Zauberwald aus dem Maerchen: Die meisten finden ihn nicht und koennen ihn nicht finden. Andere finden ihn, gehen aber lieber um ihn herum. Und selbst bei denen, die ihn finden, ist es nicht sicher, ob sich die ersehnten Abenteuer tatsaechlich einstellen. Irritieren muss das keinen: Wir aber wuenschen ihm zum Geburtstag vor allem Glueck.
THOMAS STEINFELD
Diesmal ist Peter Handke ein stiller Wilder, der ueber Umwege gegen die Bilderflut rebelliert: Muendliches und Schriftliches+
KURT FLASCH
Ich glaube, ich werde bald wieder zum Kinogeher+, so oder aehnlich denkt der Erzaehler Peter Handke. Diesen oder einen aehnlichen Beschluss fasst der Leser von Handkes schmalem Band …=Muendliches und Schriftliches+, der Reden und kleine Skizzen ueber Buecher, Bilder und Filme aus den letzten zehn Jahren enthaelt, meist Laudationes zu einer Preisverleihung oder Beitraege zu einer Bildausstellung. Der Autor tut alles, um unsere Erwartungen kleinzuhalten; es handle sich um ein paar im Sprechen entstandene Sachen+, um kleine Andeutungen+, um ein bisschen Erzaehlen. Handke erspart es uns, unter der Wucht eines neuen Hauptwerke+ zu stoehnen oder zum zehnten Mal ueber seine politische Unkorrektheit zu lamentieren; diesmal bleibt er, ein stiller Wilder, bei kleinen Objekten, aber diese Objekte = Gemaelde von Emil Schumacher oder Anselm Kiefer, Romane von Hermann Lenz oder Arnold Stadler, Bildsequenzen des Paares Straub/Huillet =haben es in sich. Wie Handke von ihnen spricht, zeigen sie einen Weltzustand der sprachlichen Verschmutzung und der Bilderflut, dem die von ihm gelobten Kuenstler durch Sprache und Bilder widerstehen.
Es ist ein Buch ueber Umwege und ueber umwegiges Sprechen.
Der Zusammenhang von muendlichem Wort, Kinoerfahrung, Roman und Gemaelde gibt dieser Textsammlung die Einheit. Es ist ein Buch ueber Umwege und ueber umwegiges Sprechen; dadurch wird es zugleich ein Buch ueber Handkes Stil, den er selbst als ein Stocken, als begriffsstutzig und als Bild gegen die Bilderflut beschreibt. Er sucht ein Sprechen, das nicht vorgeformt waere durch uebliche Sprachform. Es soll eine Sprache sein, als ob sie das Muendliche wieder erreicht haette+. Er will sehen, riechen, tasten und das Wahrgenommene zur Sprache bringen, bevor es eingesperrt wird „in den Kleingeist expliziten Denkens+. Er lobt den Filmkritiker Helmut Faerber als einen Sehdenker+; als Hoffnung gegen alle Hoffnung formuliert er quasi als Motto seines Buches: Die Bilder sind nicht am Ende+. In den Filmen, die er beschreibt, folgt der rasche, ueberraschende Wechsel der Bildeinstellung nicht einer logischen Konstruktion, sondern der internen Konsonanz der Bilder selbst, aehnlich wie Szenen in Handkes Erzaehlungen.
Deswegen fuehrt der Weg ueber das Kino. Das Kino verwandelt ein kleines Nest in eine Weltstadt. Grosse Filme wie die von Antonioni, von Yasujiro Ozu oder John Ford verzaubern den Heimweg. Es sind die wenigen Filme, die fern sind von =Maschinen, kuenstlichem Glanz und Invasorentum+. Weil sie so selten sind, geht der Sprechdenker Handke wie so manche seiner Romanfiguren nicht selten vorzeitig aus dem Kinosaal. Dieses Weggehen mitten im Film, moeglichst schnell, den Kopf gesenkt, das ist eine Handkesche Figur, in seinen Erzaehlungen wie in seinen reflektierenden Texten. Das ist Handkes ungesellige Geselligkeit. Sie bricht aus wie ein Vulkan in wuetende Polemik gegen die meisten jetzigen Filmkritiker mit ihren bloedlaessigen ahnungslosen Kintoppvisagen+.
Die Verzweiflung ueber den Stand der Dinge ist unueberhoerbar.
Es wird Leute geben, die auch das neue Buch von Handke nach solchen Rundumschlaegen absuchen. Die Verzweiflung ueber den Stand der Dinge ist unueberhoerbar; sie fuehrt zu zornigen Brandreden, etwa gegen das immer schlechter werdende Zeitungsdeutsch, selbst, wie Handke eigens hervorhebt, in der spielfreudigen Sueddeutschen+.
Andere werden das Buch autobiographisch entschluesseln, denn auch dazu laedt es ein: Die Geburt an der Grenze zwischen OEsterreich und Slowenien in einem Gelaende voller Hoehlen und Grotten erklaert, scheint es, die laendliche Begriffsstutzigkeit, den Hunger nach grenzueberschreitenden Bildwelten und den Sinn fuer Gemaelde wie die von Anselm Kiefer, die Handke als waghalsiges, grenzenerprobendes Abenteuer anschaut.
Wer vom Land kommt, fasst leichter den Beschluss, bleibend anfaengerhaft zu sehen, zu sprechen und zu schreiben. Vielleicht gelingt es ihm eher, beim Muendlichen wieder anzukommen. Handke schliesst, wie gesagt, die autobiographische Lektuere nicht aus, aber wichtiger waere es, das zu sehen, was er zeigt. Er beschreibt Kunstwerke und fasst dabei ein Denken ins Auge, das weder System noch Methode ist, vielmehr aus dem Blick- und Atemrhythmus kommt+; er leitet an, die Romane von Arnold Stadler zu lesen als die Buecher eines Kindes, als Gestaltung der Sehnsucht, der Ernuechterung und einer Verzweiflung, die ins Lustige uebergeht. Auf wenigen Zeilen charakterisiert er Karl Philipp Moritz und seine geschichtliche Stellung neben Goethe: Der Verfasser des Anton Reiser erscheint hier als der andere Goethe, stofflicher, analytischer, illusionslos+, bezeichnend fuer Moritz sei die fast schaurige Haerte, nein, Schaerfe gegen sich selbst+. Jetzt verstehen wir, warum Zitate aus dem Anton Reiser in Handkes Erzaehlwerken als Motti stehen.
Der Dichter als Traumvermesser+, das sagt Handke von Hermann Lenz; das sagt er von sich selbst. Und was er ueber gute Filme, ueber Gemaelde und einige Romane schreibt, gilt vielleicht von aller Kunst, jedenfalls von seiner: Sie zeigt das Weite, das Hochgebirge und die Niederung, also die Hoffnung und das Kleine, fast schaebige Kranke, Kritische. Darueber nachzudenken, gibt Handkes facettenreiches kleines Buch willkommenen Anlass.
PETER HANDKE: Muendliches und Schriftliches+. Zu Buechern, Bildern und Filmen 1992 = 2002. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002. 166 Seiten, 19,90 Euro.
Tages-Anzeiger; 1999-03-04; Seite 66
Kultur
Der Auftritt des nackten Textes
Bruno Ganz las Handke: Kein Abend fuer Konsumierende, aber einer fuer Lesende.
Von Christine Loetscher
Sie kuemmern sich nicht darum, was Mode ist, im Gegenteil: Das haben der Schriftsteller Peter Handke und der Schauspieler Bruno Ganz gemeinsam. Wenn der eine den anderen liest, wie das an den letzten beiden Abenden im Theater Neumarkt der Fall war, kommt dabei nicht unbedingt das heraus, was man heute von einer Lesung erwartet. Bruno Ganz, als Star und Iffland-Ring-Traeger nach Zuerich zurueckgekehrt, denkt nicht einmal daran, eine Show fuer TV-gewohnte Konsumentinnen und Konsumenten auf die Buehne zu bringen. Recht hat er. Denn das, was er mit Handkes Saetzen anstellt, kann nur in einem Raum atmen, der ganz frei von Alltagsgerede, Nettigkeiten und leeren Floskeln ist.
Tisch und Stuhl
Das bedeutet also: Keine Einfuehrung, keine Erklaerung. Kein Wort ueber Handke, wie man ihn heute kennt, als Gerechtigkeitskaempfer fuer Serbien. Es ging nicht um Handke als Person, vielleicht nicht einmal um Handke als Schriftsteller. Aber es ging um den Text Langsame Heimkehr, der dieses Jahr zwanzig Jahre alt wird. Nur das Buch und der Leser, der Tisch und der Stuhl. Der Fotograf musste verschwinden, bevor die Lesung begonnen hatte, und selbst die Wasserflasche musste mit einem Platz unter dem Tisch vorlieb nehmen. Ach ja, und das Publikum gehoerte auch dazu, zum Dreieck von Text, Stimme und Ohr. Offenbar, der Protest einer Zwischenruferin zeigte es, waren nicht alle bereit, eine Fuenfviertelstunde lang die noetige Konzentration aufzubringen. Handke und Ganz, Ganz und Handke verlangten diese aber, unbedingt.
Wer aber die Szene in Theo Angelopoulos' Film Die Ewigkeit und ein Tag liebt, in der Bruno Ganz als todkranker Alexandros eine ganze Nacht lang in seinem Wagen vor der Ampel steht, wer von seinem Gesicht inmitten der wechselnden Farben nie genug bekommen kann, der war in der Lesung am rechten Ort. Denn Bruno Ganz zeigte eine weitere Facette seiner grossen Kunst, mit einem Minimum an Bewegung ein Maximum an Ausdruck zu erreichen, diesmal in der Rolle des Lesers, der ganz im Dienst des Textes steht. Das bedeutet, ganz Sprache zu werden.
Text und Stimme
Wenn der Schauspieler das Wort Ordnung oder Form oder Evangelium aussprach, loeste sich der Alltagssinn auf, und die Vokale und Konsonanten setzten sich neu zusammen, gewannen eine neue Plastizitaet. Das Faszinierende war nicht nur, dass es Bruno Ganz gelang, die spezifische Handke-Bedeutung der Woerter in Laute zu uebersetzen, sondern dass er, darueber hinaus, auch dem Gestus des Textes eine Stimme gab. Keine wirklich schoene Stimme war es, die da erklang, nichts, was man als Musik bezeichnen koennte. Es war eben die Stimme von Handkes Naturforscher Valentin Sorger, dem die Angst im Nacken sitzt, von der Sprache verlassen zu werden, jede Tonfaehigkeit zu verlieren. Deshalb beschaeftigt sich Sorger auf seiner langsamen Heimkehr von Alaska nach Europa damit, alles, was er sieht, nachzuzeichnen, damit er das Glueck in den - wenn auch gefaelschten - Bildern findet. Gegenueber den Offenbarungserlebnissen Sorgers in der Metropole New York blitzte bei Bruno Ganz immer wieder ein ironisches Flackern in den Augen auf. Handkes metaphysische Suche gewann durch den Humor, den der Leser da und dort darin entdeckte, tatsaechlich eine neue Dimension. So etwas kann nur gelingen, wenn man einen Text ganz nackt auftreten laesst.
Theater Neumarkt., 2. und 3. Maerz, 20 Uhr
BILD THOMAS BURLA
Ganz allein mit Handkes Text: Metaphysische Suche und ironisches Flackern.
|
 BRUNO GANZ in Himmel ueber Berlin
BRUNO GANZ in Himmel ueber Berlin
|
NZZ, Neue Zuercher Zeitung, vom 11.05.1996, Seite: 68 li Literatur und Kunst Das Erwaermen der Dinge / Peter Handke oder Die Zuruecknahme des Urteils Von Peter Hamm Peter Handke hat das Schwierigste gewagt, was ein Schriftsteller nach Kafka wagen konnte, naemlich erzaehlend fuer Weltvertrauen zu werben. Seine Zukehr zur Welt resultiert aus der Anschauung der gegenstaendlichen Welt, aus der Erfahrung jener zeitlosen Gegengeschichte, die in den Medien nicht vorkommt. Inzwischen ist Handke selbst ein Besucher der Schlagzeilenwelt geworden. Die nachstehende Rede, die wir in Auszuegen wiedergeben, ist anlaesslich des Schiller-Gedaechtnis-Preises im letzten Jahr entstanden - noch vor Handkes Werben um Gerechtigkeit fuer Serbien. Ein Jahrhundert geht zu Ende - und mit ihm ein Jahrtausend, und viele aengstigt die Vorstellung, dass noch weit mehr zu Ende gehen koennte als nur ein Zeitabschnitt. Katastrophen- und Endzeitstimmung liegt in der Luft und dringt aus den Buechern. Und auch wer Peter Handkes Verdikt im Ohr hat, nach dem man den Nicht-Kuenstler schon daran erkenne, dass er das Gerede von der Endzeit mitmache, wird kaum die Augen verschliessen koennen vor den Schrecken unserer Epoche, die solches Endzeitdenken naehrten. Zeitalter der Angst, Zeitalter des Misstrauens, Zeitalter des Verrats, Zeitalter der Massen und der Massenvernichtung, Zeitalter der Woelfe und der Sonnenfinsternis, Zeitalter nach dem Tode Gottes, Zeitalter der Hoelle: das sind einige der Etiketten, die unserem verfluchten Jahrhundert - wie es in Peter Handkes Erzaehlung Langsame Heimkehr genannt wird - verpasst wurden. Wollte man diese und aehnliche Jahrhundertdefinitionen ins Literarische uebersetzen und einen Schriftsteller als Propheten oder als Seismographen unseres Jahrhunderts ausrufen, es kaeme nur einer in Frage: Franz Kafka, dessen Name es nicht von ungefaehr zu einem Adjektiv - zu kafkaesk - gebracht hat, also zu einer Sach- oder Stimmungsbezeichnung. Kein Zweifel: unser Jahrhundert war das Jahrhundert Franz Kafkas. DIE WELT ALS GEFANGNIS Koennte ich noch andere Luft schmecken als die des Gefaengnisses? Das ist die grosse Frage oder vielmehr, sie waere es, wenn ich noch Aussicht auf Entlassung haette: so endet Kafkas Erzaehlung Schlag ans Hoftor. Die Welt als Gefaengnis und in diesem Gefaengnis Menschen, die nicht wissen, fuer welche Schuld sie verurteilt wurden, Menschen, die sich in Ungeziefer verwandelt fuehlen: das ist die licht- und heillose Welt der Buecher Franz Kafkas, der sich, wie er es in Ein Landarzt ausdrueckt, nackt dem Froste dieses unglueckseligen Zeitalters ausgesetzt sah und sich Erloesung nur noch als Endzeitkatastrophe denken konnte. So verraet es seine Erzaehlung Das Stadtwappen: Alles, so heisst es da, alles was in dieser Stadt an Sagen und Liedern entstanden ist, ist erfuellt von der Sehnsucht nach einem prophezeiten Tag, an welchem die Stadt von einer Riesenfaust in fuenf kurz aufeinanderfolgenden Schlaegen zerschmettert werden wird. Deshalb hat auch die Stadt die Faust im Wappen. Erinnern Sie sich noch an den Schluss von Kafkas Roman Der Prozess? Zwei Herren holen da Josef K. aus seiner Wohnung und fuehren ihn zu einem Steinbruch unmittelbar am Rande der Stadt, wo einer der beiden Josef K. mit einem grossen Fleischermesser exekutiert. Obwohl Josef K., wie Kafka es formuliert, genau wusste, dass es seine Pflicht gewesen waere, sich selbst mit diesem Messer zu toeten, bringt er die Selbsthinrichtung nicht ueber sich. Unmittelbar bevor Josef K. stirbt, faellt sein Blick auf das an den Steinbruch angrenzende Haus, in dessen oberstem Stockwerk sich ploetzlich ein Fenster oeffnet und sich ein Mensch zeigt: Ein Mensch schwach und duenn und in der Ferne und Hoehe beugte Er sich mit einem Ruck weit vor und streckte die Arme noch weiter aus. Wer war es? Ein Freund? Ein guter Mensch? Einer der teilnahm? Einer der helfen wollte? War es ein einzelner? Waren es alle? War noch Hilfe? Warum ich Kafkas Prozess und sein Ende in Erinnerung rufe? Weil ich in dem Mann im Fenster, von dem Josef K. Teilnahme, vielleicht sogar letzte Hilfe erhofft, oft Peter Handke gesehen habe. Weil mir Peter Handkes erzaehlerisches Werk insgesamt als der immer neue Versuch einer Zuruecknahme von Kafkas Prozess erscheinen will, als - das grosse Wort sei gewagt - Erloesung Franz Kafkas, mithin Erloesung des Zeitalters. Die Auseinandersetzung mit Kafka durchzieht Handkes Werk. Schon sein 1967 erschienener Prosaband Begruessung des Aufsichtsrats enthaelt eine siebzehnseitige Nacherzaehlung von Kafkas Prozess-Roman, an der auffallend ist, dass Handke - mit einer minimalen, aber bezeichnenden Korrektur Kafkas - aus Josef K.s Weigerung, sich selbst zu toeten, einen Akt stolzer Verweigerung macht, waehrend bei Kafka diese Weigerung als Schwaeche Josef K.s erscheint, als Fehler: Die Verantwortung fuer diesen letzten Fehler, so Kafka, trug der, der ihm den Rest der dazu noetigen Kraft versagt hatte. Wer sonst koennte damit gemeint sein als der Schoepfer, der bei Kafka kein Erloeser ist? In einer 1974 veroeffentlichten kurzen Notiz Zu Franz Kafka, in der Peter Handke zunaechst bewusst respektlos gegenueber dem ewigen Opfer Kafka von dessen Pickeln und Frauengeschichten spricht, spinnt er dann so etwas wie eine Erloesungsphantasie: Wenn ich an Kafka denke und ihn vor mir sehe, habe ich das Gefuehl, ich muesste ihn nur geduldig anschauen, vielleicht auch zwischendurch den Kopf senken, um ihn nicht zu verletzen - und er wuerde nach und nach aufhoeren, das blosse Bild eines Opfers zu sein, und etwas ganz anderes werden, und davon erzaehlen, aber mit derselben Gewissenhaftigkeit wie vorher. Peter Handke hat das Schwierigste und Hoechste gewagt, was ein Schriftsteller nach Kafka ueberhaupt wagen konnte, naemlich - ich moechte es so einfach sagen - erzaehlend wieder fuer Weltvertrauen zu werben und Weltvertrauen zu schaffen. Das bedeutet: das Dasein nicht mehr als Daseinsverhaengnis zu verwerfen, sondern es, ohne dabei die vielen Formen der Daseinsnot zu unterschlagen, als Daseinsgabe aufzufassen und anzunehmen, als Daseinsaufgabe. Fuer den Schriftsteller kann diese Aufgabe nichts anderes sein als das rechte Erzaehlen vom Dasein - und das ungeachtet einer kulturellen Stimmungslage, in der als Signum des Bedeutenden und der Modernitaet zumeist das gerade Gegenteil gilt, naemlich die Schmaehung des Daseins in immer finstereren, immer blutigeren Endspielen, die aber kaum je aus Kafkas (oder Becketts) Not geboren werden, sondern marktkonformer Verzweiflungsroutine entstammen. Kafka hat sich einmal apostrophiert als den enterbten Sohn. Um eine Weltvertrauen schaffende Literatur zu verwirklichen, bedurfte Handke eines Erbes, musste er die Kunst zu erben (Hanns Eisler) erlernen und in eine andere Tradition eintreten als die von Dostojewski zu Kafka reichende - in eine klassische und antitragische. Handkes Bekenntnis zur Klassik, das er 1979 in seiner Dankrede fuer den Kafka-Preis abgelegt hat, wurde ihm seltsamerweise von manchen als Anmassung ausgelegt; als ob wirkliches Kuenstlertum ohne solche Anmassung - und das heisst ja nichts anderes als an anderen Mass nehmen - ueberhaupt auskommen koenne. Das Wort sei gewagt, so formulierte Handke damals, ich bin, mich bemuehend um die Formen fuer meine Wahrheit, auf Schoenheit aus - auf die erschuetternde Schoenheit, auf Erschuetterung durch Schoenheit; ja, auf Klassisches, Universales, das, nach der Praxis-Lehre der grossen Maler, erst in der steten Naturbetrachtung und -versenkung Form gewinnt. Viele meinen heute, die Natur gebe es gar nicht - oder bald nicht mehr. Fuer Kafka gab es sie nie. Peter Handke verdanken wir die eindringlichsten Naturbeschreibungen seit Stifter. Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthuellen anfaengt, der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer wuerdigsten Auslegerin, der Kunst, schrieb Goethe. Es sind vor allem die grossen Naturausleger unter den Klassikern, die Diener des Sichtbaren, wie Handke sie einmal nennt, zu denen er sich hingezogen fuehlt. Dazu gehoeren nicht nur Homer, Vergil, Goethe, Stifter und auch der Goethe-und-Stifter-Bewunderer Nietzsche, der einmal aeusserte, kein Gedanke sei etwas wert, der nicht im Freien gefunden worden sei, es gehoeren dazu auch Maler wie Cezanne, den Handke ausdruecklich seinen Lehrmeister nannte und dessen Beispiel ihn zu einem seiner lichtesten Buecher ermuntert hat, Die Lehre der Sainte-Victoire. Es war aber dieser Cezanne, von dem der Ausruf kam: Es steht schlecht. Man muss sich beeilen, wenn man noch etwas sehen will. Alles verschwindet. So wie fuer Cezanne Natur keine gegebene Harmonie war und er sie malend erst erschaffen musste - er male nicht nach der Natur, sondern schaffe seine Bilder als Konstruktionen und Harmonien parallel zur Natur, sagte Cezanne -, ist auch fuer Handke Natur nichts beliebig Verfuegbares und schon gar nicht ein Freiluftmuseum fuer Heilsucher, sondern etwas Aufzuspuerendes, eine andauernde Aufgabe. In seinem Theaterstueck UEber die Doerfer heisst es von der Natur: Sie kann weder Zufluchtsort noch Ausweg sein. Aber sie ist das Vorbild und gibt das Mass: dieses muss nur taeglich genommen werden. Gleichermassen ist die Klassik fuer Handke keine Weimarer Firma, der man als Juniorpartner beitreten koennte, sondern etwas gegen grosse Widerstaende Freizulegendes, Freizuphantasierendes. Es ist keine Verkleidung oder historische Maskerade, wie sie etwa Thomas Mann in seiner Lotte in Weimar veranstaltete, und keine klassizistische UEbernahme ueberkommener Formen, wie wir sie etwa bei Hans Carossa finden - vor dem Klassizistischen, das ein Zeichen des Buergerlichen sei, so Peter Handke, bewahre ihn das Pathos seiner Herkunft -, es ist bei Handke vielmehr - so hat er es selbst ausgedrueckt - stete Verwandlung ins Unverkleidete. Es ist ja nicht nur viel verschwunden, sondern auch etliches hinzugekommen, und Berufung auf Klassik heisst bei Handke keineswegs Abwehr der Gegenstaende des technischen Zeitalters. Im Gespraech mit Hermann Lenz verteidigte Handke die von Lenz so ungeliebten technischen Gegenstaende als durchaus literaturwuerdig, und in seinen Buechern erscheinen sie immerzu im klassischen Sinne wahrgenommen, d. h. durch die Art der Wahrnehmung, durch die Einheit von Gewahrwerden und Vorstellungskraft, immer auch schon wieder ins Naturhafte verwandelt - seien das nun Reklamebilder, die Jukebox, die Oberleitungsdraehte der Busse oder die nasse Betonpiste des Salzburger Flughafens, die Loser, der Chinese des Schmerzes in der gleichnamigen Erzaehlung, vom Fenster des Flughafenhotels aus unterm Vollmond in einen stillen See verwandelt sieht. Dieses 20. Jahrhundert hat freilich viel dazu getan, den Weg zu den Klassikern zu verstellen und zuzuschuetten mit Truemmern aller Art. Wenn Peter Handke in seiner Geschichte des Bleistifts, jenem Journal, in dem auf fast jeder zweiten Seite die Klassiker angerufen werden, einmal schreibt: Ich kann von den Klassikern sagen, dass sie mich gerettet haben, so ahnt man schon, dass solcher Rettung viel Verlorenheit - auch Verlorenheit an dieses Zeitalter - vorausging. Dichter wird man als Kind, schrieb die russische Dichterin Marina Zwetajewa, und, moechte ich hinzufuegen, man wird es durch die Katastrophen - auch die lautlosen Katastrophen - der Kindheit. Im Jahr 1942 geboren und zwischen 1944 und 1948 in Berlin aufgewachsen zu sein, also gewissermassen im Zentrum der Geschichtskatastrophe, dazuhin vaterlos, und in der Nachkriegszeit dann einem gewalttaetigen Stiefvater und einem bornierten katholischen Priesterseminar ausgeliefert, schliesslich den Selbstmord der Mutter nicht verhindern zu koennen - das bedeutete nicht nur, sich schuldlos verurteilt zu fuehlen und Kafkas Angste mit allen Poren einzuatmen, das bedeutete auch, den Glauben an das Schoene, Wahre und Gute nachhaltig in sich und in der Welt erschuettert zu sehen. Wie denn sollten diese Begriffe je wieder etwas wert werden? Vielleicht nur - und das haben mich vor allem Peter Handkes Buecher gelehrt - mittels Minimalisierung: das Wahre waere dann nur das jeweilige Gewahrwerden, das Gute das jeweils Beguetigende und das Schoene - nein, nicht das Beschoenigende, aber das jeweils Verschoenende, eine andere Art der Belichtung, eine aufhellende. Der blosse Versuch, eine Tragoedie zu schreiben, wuerde ihn vernichten, gestand Goethe einmal Eckermann. Es ist neben diesem antitragischen Impetus Goethes vor allem dessen ganz auf Anschauung und Betrachtung gerichtetes Denken, das seine Anziehungskraft auf Handke ausuebt. Handkes Zukehr zur Welt - sein Ja zur Welt - resultiert aus Erfahrung und Anschauung der sichtbaren, der gegenstaendlichen Welt und ist implizit Abkehr von der geschichtlichen Welt. Das Werk Handkes ist - um einen Buchtitel von ihm aufzunehmen - eine Langsame Heimkehr zu jener Geschichte, die in den Medien nicht vorkommt. Allen Buchhelden seit seiner Erzaehlung Langsame Heimkehr erwaechst das Heil aus dieser Geschichte, die nichts anderes ist als das Ewige im Alltaeglichen. Und dieses Ewige ist immer das Unscheinbare; oder: das Unscheinbare im taeglichen Ablauf, das ist das Ewige. Die taeglichen Verrichtungen wie der morgendliche Griff zur Teekanne, ein vorbeitreibendes Blatt, ein bestimmter Lichteinfall in einer Strasse, ein Schriftzeichen an der Wand, der Blick eines Passanten: es sind diese fuer gewoehnlich gar nicht mehr bis in unser Bewusstsein vordringenden Erscheinungsformen des taeglichen Lebens, die die eigentliche Substanz unseres Lebens bilden - und ohne die das Gewicht der Welt nicht zu tragen waere. Handkes Erzaehlideal ist zunehmend der hohe sachliche Ton der grossen Geschichtsschreiber geworden, nur dass er mit der nachdruecklichen Nuechternheit dieser Geschichtsschreiber nicht mehr Geschichte, sondern Gegengeschichte schreibt. Ein Buch fuehrt im Titel den Namen des Erfinders der modernen Geschichtsschreibung, der die Geschichte des Peloponnesischen Krieges aufgezeichnet hat, doch in Handkes Nocheinmal fuer Thukydides sind es ein Wetterleuchten, eine Esche am Muenchner Siegestor, ein alter Schuhputzer in Split oder die Formen der Kopfbedeckungen in Skopje, die wie historische Ereignisse berichtet werden. Einer der kurzen Texte aus diesem Buch traegt den programmatischen Titel Versuch des Exorzismus der einen Geschichte durch eine andere. Darin wird beschrieben der sonnige Sonntagmorgen des 23. Juli 1989, an dem der Erzaehler vom Hotel Terminus am Bahnhof Lyon-Perrade aus das Gleisfeld uebersieht, ueber das die Eisenbahner mit ihren Akten- oder Plastictaschen hin- und hergehen, waehrend ueber ihnen die Schwalben im Flug Faltkniffe in den Himmel machen. Irgendwann kommt ihm in den Sinn, dass das Hotel Terminus im Krieg das Folterhaus des Klaus Barbie war - und er sieht jetzt die Schwalben, das Blattwerk einer Platane, einen Eisenbahner mit schwarzer Aktentasche, der, seines Ziels gewiss, seinen Weg geht im Schaukelgang, und den blauen Falter, der auf einer Schiene landet und in der Sonne blinkt, noch bewusster als Epiphanien der Gegengeschichte. DER EWIGE EPIKER Nein, eine Flucht in eine heile Sonntagswelt ist das nicht; Handkes Kurzepos schliesst mit dem Satz: Und die Kinder von Izieu schrien zum Himmel, fast ein halbes Jahrhundert nach ihrem Abtransport, jetzt erst recht. Aber es ist doch der Versuch, dem Geschichtsunheil nicht das letzte Wort zu lassen, sich von ihm nicht blind machen zu lassen, fuer die andere Geschichte. In Peter Handkes Phantasien der Wiederholung findet sich ein Schluesselsatz: Kein Jesus soll mehr auftreten, aber immer wieder ein Homer. Wer um Handkes Verwurzelung im Katholizismus seiner Kindheit weiss, wird in diesem Satz nicht den Schimmer einer blasphemischen Absicht erblicken. Indem Handke nicht den Erloeser am Kreuz, nicht das Marterbild, sondern den ewigen Epiker, den Epiker der ewigen Wiederkehr, anruft, ruft er allerdings, wie schon Nietzsche vor ihm, nach der Erloesung von der Erloesung. Erloesung waere, ihrer nicht mehr beduerftig zu sein. Erleuchtend waere allein schon die Wahrnehmung der Welt und das Wiederholen der Welt in der Erzaehlung von der Welt. Vom ewig wiederholenden Erzaehler spricht Goethe, und ein Imperativ in der Langsamen Heimkehr lautet: Sinn fuer Wiederholung kriegen! Dort traeumt Sorger von dem geglueckten Tag, an dem allein die Tatsache, das es Morgen und Abend, hell und dunkel wuerde, Schoenheit genug waere. Das Schoene sieht man so schlecht, sagt das Kind einmal in Handkes Kindergeschichte. Handke macht, dass man es ueberhaupt sieht, aber er illuminiert es nicht phantastisch mit kuenstlichem Licht. Phantasie heisst bei ihm nicht etwas erfinden, sondern etwas wiederfinden, etwas UEbersehenes wieder und wie neu sehen. Phantasie ist fuer ihn eine Art Erwaermen der Dinge. Als ewigen Anfaenger hat sich Peter Handke im Nachmittag eines Schriftstellers bezeichnet; aber, so moechte ich hinzufuegen, es ist gerade dies seine Kunst, ewig ein Anfaenger zu bleiben. Fuer den Schriftsteller ist jeder neue Tag der erste Schoepfungstag - und der Schriftsteller, der sagt, er habe jetzt seine Sprache gefunden, hat sie schon verloren. Und gerade das Ja zur Welt darf nie siegesgewiss gesagt werden, es muss jeden Tag neu erlernt werden und muss zaghaft und zittrig bleiben und auch von jener innigen Ironie durchdrungen, die Handke schon den Schauspielern seines Stuecks UEber die Doerfer anempfahl. Als Peter Handke den Schluss seiner Erzaehlung Langsame Heimkehr abtippte, hatte er, wie er einem Befrager gestand, auch koerperlich die Vorstellung, dass diese zehn Seiten ein Gegenentwurf zu den letzten zehn Seiten des Romans von Kafka sind; es sei ihm aufgegangen - und nun soll Handkes Nacherzaehlung seiner Erzaehlung fuer sich sprechen, dass da eine ganz andere Weltstruktur vorgeschlagen wird, aber ganz konkret, doch genau so zittrig und jaemmerlich, und auch zugleich in der Form so gewissenhaft und ereignishaft, dass ich denke: Da muss doch jedem das Herz aufgehen - wenn er dann liest, wie Sorger sich schlafen legt in seinem seltsamen Hotelzimmer, wie er traeumt, wie er als Traeumender sozusagen die Wurzel Jesse aus dem Alten Testament nachbildet, wie er all die Personen im Verlauf seiner Erzaehlung im Traum wiedertrifft . . . wie er dann am Morgen aufsteht, bevor es noch hell wird, wie es Morgen wird, wie der Schnee von den Baeumen staubt, wie unten der Teich des Central Park von New York ganz allmaehlich andere Farben annimmt . . . wie er dann denkt: Ja, Sinn fuer die Wiederholung kriegen, hinunter zu den Leuten . . . wie er dann sozusagen wiederholt, wie er als Kind zur Kirche ging, wie dieses ungeheure Ereignis des Niederkniens stattfindet in einem Satz . . . wie er begreift, was die Symbolkraft der Wandlung in einer Messe ist . . . Und immer so weiter. Autor: AA Auswaertige Autoren Datenbank NZZ Dokumentnummer 0596110155
Dokument 5 von 6
NZZ, Neue Zuercher Zeitung, vom 17.12.1994, Seite: 65 li Literatur und Kunst Mit der Welt versoehnt / Peter Handkes Erzaehlung Mein Jahr in der Niemandsbucht Von Martin Meyer Ein bedeutendes Werk liegt vor: Peter Handke hat ein Epos geschrieben, welches mit hoechstem Kunstverstand von der Berufung eines Schriftstellers in seiner Zeit erzaehlt. Und haette er nur dieses eine Buch geschrieben: wir wuessten wieder, was der Kuenstler tut. Er sieht die Welt, in ihrem durchlaessigen Scheinen. Er holt sie, ganz ohne Zwang, zu sich heran. Stueck um Stueck verwandelt er sie, bis sie wirklich da ist - so praesent, so gegenwaertig, dass Notwendigkeit aus ihr spricht. Die Welt als Buch, als Nachbild der Schoepfung. Hat das mit Religion zu tun? Gewiss; schon deshalb, weil der Nachbildner immer achtsam bleibt fuer das, was ist. Er versenkt sich in die Dinge mit dem Wohlwollen der Betrachtung, wo alles zusammenschliesst; mit dem Mut des Glaubens, wenn das Chaos schreit. Warum sollten Mystik und Moderne nur Gegensaetze sein? Ein Maerchen aus den neueren Zeiten nennt Peter Handke seine grosse, ueber tausend Seiten ausgreifende Erzaehlung. Nicht zu Unrecht beansprucht er die Gattung - wobei es ihm auf den geschichtlichen Hinweis durchaus ankommt. Wehrt denn die Jetzt-Zeit nicht jede Verschiebung - ins Maerchenhafte, ins Zauberische - zum vornherein ab? Dann muesste das poetische Unternehmen nicht bloss mit dem Stoff, sondern auch mit der Gleichgueltigkeit ringen. Darin aber gruendet die Herausforderung. Und sie ist um so groesser, als selbst dem Autor der UEbergang vom Gewoehnlichen zu seiner Verklaerung - heute und hier - wie ein Pensum des aeussersten Kraeftemessens entgegenschlaegt. O nein; dass einer kaeme und voll der Naivitaet uns nochmals vom Guten und Schoenen erzaehlte - oder auch nur von der ungefaehrdeten Wahrheit -, solches verboete sich allerdings. Handke weiss es. Schon in der Autorschaft bricht der Konflikt auf: zwischen Gemeintem und Gesagtem, zwischen dem Wunsch, der Sache habhaft zu werden, und der Furcht, dass ueberall die Taeuschung lauert. So muss der Erzaehler - immer wieder - auch davon berichten. Vom Abenteuer seines Wegs, von den Moeglichkeiten der Niederlage, die das Schreiben bedrohen. k Was erzaehlt wird, ist das eine. Wie erzaehlt wird, ist das andere. Die Wahl des Ich-Erzaehlers - abgesehen davon, dass sie den Schriftsteller selbst, am Rande, ins Spiel bringt - beguenstigt das Thema des Wie. Und wahrhaftig: kein ausgeruhter Chronist geht hier zu Werk, vielmehr ein Grenzgaenger. Einer, der im Sozialen das Gemeinschaftsgefuehl so gut kennt wie das Alleinsein; in der Kunst oft schwankt zwischen der genauen Schaerfe des Wortes und der Unbestimmtheit des gedanklichen Rhythmus; im Philosophischen schliesslich beides will, Erloesung fuer die Geschichte (ja, der Menschheit) und zugleich die Begegnung mit den Urbildern - mit jenen Formen und Gestalten, die hinter der erscheinenden Welt taetig sind. Ewigkeit und Erbarmen. Von Krisen und Zweifeln muss deshalb am Anfang die Rede sein. Bald sechsundfuenfzig Jahre alt ist Gregor Keuschnig; doch gesteht er, dass er sich eigentlich nicht kenne. Auf eine Verwandlung wartet er, auf einen Aufbruch; aber das Projekt des Kuenstlers wird durch falsche Erwartungen und schiefe Gewissheiten wiederholt gestoert. - Der ganze erste Teil der Erzaehlung kreist um die eine Frage: wie es gelingen koennte, den Lebensirrtum zu bannen, um ein Epos von Transparenz und Sinnfaelligkeit maehlich, Schritt fuer Schritt zu entfalten. Es vergegenwaertigte - dann - die Neue Welt. Nichts Geringeres. Bezeichnend allerdings ist, dass Keuschnigs fruehere Biographie dazu wenig beizutragen vermag. Frueher war er Jurist, und irgendwann begann er zu schreiben - Novellen, Prosastuecke. Wie ein unerwecktes Versprechen leuchtet die Kindheit (in einem oesterreichischen Dorf) auf seine Gegenwart; die aber ihrerseits noch verschattet ist: durch die Beziehung zur Familie, durch das Verhaeltnis zu den Freunden, ueberhaupt durch eine Bereitschaft zur Entzweiung. Daher denn Menschen, Orte und Ideen auch im Besten jaeh den Umschlag provozieren - die Abwendung ins Nichts. k Einerseits das Nichts, als Mangel und Entzug, mit aggressiveren Vorzeichen: als die schimaerische Welt. Hier tritt die Entzweiung mit ungeschminkter Feindseligkeit auf. Anderseits - und ebenso aus der Not des Ichs gewachsen - dessen Hang, alles und jedes ohne Luecken und Zwischenraeume in die Vollstaendigkeit eines Ganzen ueberleiten zu wollen. Ganzheitswahn, notiert Keuschnig; oder, zu sich selbst, deine Folgegier. Und die - prekaere - aesthetische Maxime dafuer lautet: Fragmentarisch erleben, ganzheitlich erzaehlen. Das meint das Wort vom Lebensirrtum, welchen freilich noch ein zweites Verhaengnis auszeichnet: die Gestimmtheit, auch die vollkommene Gegenwart als eine blosse Adventszeit wahrzunehmen. Womit gilt, dass, zum einen, das Gegebene dem Begegnenden stets sich entfremdet, verdreht, ins Falsche kippt; dass, zum anderen, noch der freieste Augenblick belastet und getruebt wird durch Gedanken an die Zukunft. Was ist, ist - in Wahrheit - nicht. Was einfach sein koennte, darf nicht so sein. Und der Kunst, um die es letztlich ginge im Blick auf die Erloesung der Gegensaetze, scheint jedes Bemuehen aeusserlich zu bleiben. Sie kommt nicht zur Sprache, denn der da sprechen will, bietet bloss Beredsamkeit auf. So muendet Handkes lange Ouvertuere von der education sentimentale seines Schriftstellers Gregor Keuschnig absichtsvoll in der Aporie. Doch: das stimmt so gut, wie es nicht stimmt. Indem naemlich Keuschnig das Widerstaendige zu benennen, ja: episch zu ordnen versteht, oeffnet sich der andere Weg. Er erinnert sich, zum Beispiel, an seine Lektuere des roemischen Rechts; da erschien ein Auffaechern, ein Lichten, ein Durchlueften des Chaos oder der sogenannten Wirklichkeit. Er bemerkt, wie unverbildet und gespannt sein Sohn, Valentin, diese Wirklichkeit zerlegt und wieder zusammenfuegt. Und er weiss, dass ein paar Freunde in der Welt unterwegs sind. k Waere es moeglich, das Erzaehlen im Schwunge der Zwischentoene zu halten? Koennte es gelingen, mit dem Auge des Kindes das fest Verstrebte, boesartig Kompakte zu loesen, aufzutun? Duerfte es statthaft, sogar notwendig sein, die Geschichten der Freunde aufzunehmen in die Geschichte - um damit der monomanen Subjektivitaet und Eigenmaechtigkeit des einzigen Autors zu entgehn? - Seit laengerem wohnt Keuschnig in einer Vorstadt der Pariser Seine-Hoehen. Die Gegend wirkt vielleicht banal, jedenfalls unheroisch; bescheidener Alltag. Sollte aber dem Autor eben hier, wo alles gleich viel gilt, der Ton des Erzaehlens aufklingen, die Harmonie des unverfaelschten Ganzen? Darauf laesst sich Keuschnig noch nicht ein. Statt dessen berichtet er - abermals - von seiner Biographie; naeherhin von den Orten (der Kindheit, der Jugend), da ihn einzelne Epiphanien erreichten - oder, umgekehrt, der Schmerz von der Unfassbarkeit der Welt ihn durchdrang. Der Kirschbaum des oesterreichischen Dorfes, machtvoll ein Stueck Natur; die einsamen Uferfelsen am Hafen von Piran; das Hochland der franzoesischen Pyrenaeen; und dagegen, immer fremder, die stumm gewordenen Monumente der grossen Staedte. Berichten, erzaehlen wollen. Nun lenkt freilich Handke seine Figur in der Weise, dass auch dieser zweite Teil keine Geschichte heranbilden darf. Noch und noch sieht sich Keuschnig vor dem Abbruch der Linie, welche die Stoffe baende. Immer wieder setzt der Satzfaden aus, der das Ganze umgarnte. Heimtueckisch verknotet sich das Schreiben - dem doch aufgegeben waere, den Entwurf der Neuen Welt zu leisten als ein erzaehlendes Gebet. Alles bloss Chimaere? Panik kontert das Beduerfnis nach Erloesung, Verzweiflung ruft: Wer oder was war schimaerisch, die Welt? Das Zeitalter? Ich? k Ende der Verwandlung. Doch: auch dies stimmt nicht ganz. Denn in dem scheinbar so ungestalten Hin und Her von Wollen und Unvermoegen haben sich Spuren geformt; Konstellationen von Erfahrung, die sehr sanft, behutsam auf den richtigen Horizont verweisen. Wie in freier Variation zu Prousts recherche machen sich dem Ich-Erzaehler je und je Begebenheiten bemerklich. Etwa: eine Wanderung im Winterfrost; das Farbenspiel einer Haeuserzeile; der Regentropfen, in dem sich der Kosmos spiegelt; das Muster von Straeuchern und Wind an der Bahnsenke; oder die Dichte der Nacht (der Sohn schlaeft) im Zentrum der Zeit. - Sie bezeugen die memoria, das Eingedenken so gut wie den Augenblick absoluter Gegenwaertigkeit. Und sie erzeugen einen Raum - zuletzt: des Schreibens -, welcher die Fuelle der Welt dereinst ohne Dramatik, ohne Zwischenfaelle aufnehmen koennte. Mag die Geschichte stocken, ihre Latenz zieht an. Von einer gelungenen oder auch nur gelingenden Verwandlung kann Keuschnig noch lange nicht sprechen. Sie bedeutete naemlich nicht weniger als die meta-physische Erloestheit; den Einklang ohne das mit, ohne den Objektbezug, der die unberuehrte Frische der Dinge immer schon verunstaltet. Vermoegen aber die Worte fuer wenige Perikopen diese Frische hervorzuholen, ist etwas bereits gewonnen. Etwas: Aufhellung. Und es gibt dafuer Belege; Passagen von unvergleichlicher Leichtigkeit, weit im Atem der Sprache. . . . heute frueh, die Osterwoche hat angefangen, mit Sturm und diesigem Regen, sah ich das inmitten des allgemeinen Schwankens fast unbewegte, nur klein wenig geruettelte Geaest der Koenigseiche, daneben und dazwischen ein wildes Gewuehle, ein Aufwallen von Gruen, von den Schoepfen der Birken, die sich als die ersten Waldbaeume ganz belaubt haben, und am Rand die Bluetenfackel einer einzelnen Wildkirsche, einzelnes Gespinstweiss da dort im Waldinnern, weit weg von allem sonstigen Bluehen vorn in den Vorstadtgaerten, waehrend die vorherrschende Farbe der Aue immer noch das Grau war, ein sporadisches, umso staerker gleissendes Vorfruehlingsgrau, dessen Licht quer durch den Wald aus dem Osten kam und sich buendelte in den Zweigruten und in den fuer die Seinehoehenbaeume typischen Mehrfach- und Stangenstaemmen. Kein Mensch da zu sehen, und doch erscheint die Aue als Fenster zur Welt. k Kein Mensch da zu sehen. Da: im Daneben und Dazwischen der Waelder, die sich um die Vorstadt von Paris legen. Diese Gegend, unbemerkt vom Auge fuers Erhabene, ist der entscheidende Ort. Sie prueft des Autors Lernen, noch das Beilaeufigste zwanglos ins Recht zu setzen: mit der Vertrauensseligkeit des Mimetikers, des Nachbildners. In solchen Momenten waechst Gregor Keuschnig ueber sich selbst hinaus - er tritt hinter sich selbst zurueck. Allein, auch das kann nicht genuegen. Kein Mensch zu sehen: beduerfte es nicht der Menschen, der in der Naehe wie in der Ferne Naechsten, die Lebenswelt in die Welt des ungeschmaelerten, ganzen Lebens zu verwandeln? Deshalb versucht sich der Ich-Erzaehler - im dritten Teil - mit der Geschichte seiner Freunde. Zu den Gefaehrten, deren Spur nun aufgenommen werden soll, zaehlen: der Saenger und der Leser; der Maler, die Freundin und der Architekt; der Priester und Valentin, der Sohn. Im Pariser Vorstadthaus imaginiert Gregor Keuschnig deren Geschichten - wo sie auf Reisen sind oder, wie der oesterreichische Dorfpfarrer, am Ort ihre Arbeit tun; wo sie, dies vor allem, ihrem Wollen nachdenken und dabei auf merk-wuerdige Begegnungen stossen. Sie sind, jeder fuer sich, allein; zugleich aufgehoben in ein gemeinschaftliches Schicksal. Nicht, dass ihnen das Glueck dabei zustroemte; im Gegenteil. Etwa der Leser: Sein ganzes bisheriges Leben war bestimmt gewesen von Aussichtslosigkeit. Dann der Saenger. Verlaeuft sich im schottischen Hochland, quaelt sich mit dem Sterbensbeduerfnis. Der Maler, erfolgreich wie wenige andere - ploetzlich verliert er das Gefuehl fuer die Distanzen. In Japan, als ziel- und mittelloser Wanderer, spuert der Architekt, dass er noch gar nicht geboren sei. Der Priester, ein Spaetberufener mit dunklen Visionen. Die Freundin ist die einzige Sorglose, doch auch ihr faehrt der Wunsch vom Zugrundegehen zwischen das unbekuemmerte Dasein. Bleibt, zuletzt, der Sohn. k Und dem Sohn gelingt es vielleicht am ehesten, was Keuschnig fuer alle - und damit auch fuer sich: fuer seine Geschichte - erwartet. Auch Valentin malt, mit dem jugendlichen Misstrauen des bildenden Kuenstlers gegenueber dem Wort. Eine Reise lenkt ihn von Slowenien bis nach Griechenland, aber ueberall weist ihn - Ortsfremdheit - die Gegend ab. Zwar spuert er die Nachbilder auf: jene Wesenheiten, die hinter der unmittelbaren Erscheinung nachhaltig aufschimmern (durch das blosse Streifen des Gegenstands). Indes versagt er sich das Interesse an der Anschauung, und fuer die Geschichte, im Sinne der Historia, fehlt ihm gar jedes Interesse. Bis er in eine griechische Kirche kommt. Dort sieht er ein Fresko mit dem Auferstandenen. Jetzt ereignet sich der ergaenzende Umschwung. Das ist das Bild, mit dem die Welt neu anfangen wird. Die Epiphanie der Ding-Welten draengt weiter, und nun erhaelt sie, zusaetzlich, die zeitliche Dimension: die Hoffnung, nein - die Gewissheit, dass Erloesung stattfinden wird. Gibt es Stufen, Entwicklungswindungen, welche solche Erkenntnis befoerdern? Bei genauerer Lektuere der Geschichten seiner Freunde zeigt sich, dass Keuschnig mit jeder Episode - angefangen beim Saenger, endend bei dem Sohn - eine neue Etappe erreicht. Zur Leiter (das Bild taucht spaeter ausdruecklich auf) schliessen die verschiedenen Schicksalsstationen zusammen - zu einem Sog in die Hoehe der Transzendenz. Denn vom Nichts oder doch vom Zweifel und vom Weltverdruss muss erst ueberwaeltigt werden, wer schliesslich Anteil nimmt an der Versoehnung. So uebergreift die education den Bewusstseinsakt. Die Lehr- und Wanderjahre dieser Figuren schaerfen nicht nur den aesthetischen Sinn. Sie holen zuletzt das Metaphysische herbei: im geglueckten Dasein. k Weshalb Gregor Keuschnig nun nochmals ansetzt. Nochmals beschreibt er die Landschaft der Seine-Hoehen, die sich ihm oeffnet als eine weite, vielgestaltige Bucht. Die Waelder, die Huegelzuege, die darin eingesprengten Haeuser, das Rauschen der Vorortszuege - Takt um Takt changiert die Niemandsbucht zum Ideal von Bewohnbarkeit. Und nochmals laesst Handke die Zeitstruktur des ganzen Werks hier sich wiederholen. Zuerst ueberblickt der Ich-Erzaehler das Jahrzehnt seines Aufenthaltes. Dann schildert er das vergehende Jahr. Am Ende muendet es in den letzten Tag. - Und was geschieht? Denkbar wenig, unendlich viel. Keuschnigs Maxime heisst: In-eins-Gehen mit dem Gefuehl, dem Herzschlag, oder dem rhythmischen Bild. Stoffliche Anschaulichkeit erhaelt sie nicht mehr bloss durch die mystischen Isolationen von frueher. Jetzt fuegt sich das eine zum andern, das naturhafte Geschehen zur Geschichte der Menschen. Im Wald eine Felsschlucht; unter Baeumen, am moosigen Grund, die Pilze; die Pilzsucher; ein Teich, schwarz und verwunschen. Ein Kind, Halbwaise, Vladimir; dessen Spielen, von unberuehrter Glaeubigkeit. Mir war, solch ein Miteinander wirke auf mein Erzaehlen als eine Beglaubigung. Die Freunde, nochmals. Gregor Keuschnig hat sie eingeladen fuer jenen letzten Tag, zum Fest im Wirtshaus Aux Echelles (die Leiter). Vorher treffen Nachrichten von ihnen ein. Bedeutendes und weniger Bedeutendes wird vermeldet, der Chronist ordnet die Botschaften - und erwaehnt (jetzt erst) jeden der Gefaehrten mit seinem Namen. Fuer die Feier aber soll gelten: Die Welt ist voll dunkler Farben der Gemeinschaft zwischen Unbekannten. k Haette Peter Handke nur dieses eine Buch geschrieben: wir wuessten wieder, was der Kuenstler tut. Er verfasst nicht einfach einen Text (mit anderen Texten, fuer weitere Texte). Er erzeugt das Bild der Schoepfung, wo Wiedererkennen herrscht. Man muss es so sagen, gegen die Totenstarre einer Kunst von Lettern. Ein Buch lesen, welches die Welt neuweht - wahrhaftig, so ists. Langsam, langsam beginnen wir diese Welt wieder zu sehen. Peter Handke: Mein Jahr in der Niemandsbucht. Suhrkamp, Frankfurt 1994. 1069 S., Fr. 78.-. Autor: mey Martin Meyer Datenbank NZZ Dokumentnummer 1294170162
Dokument 6 von 6
FOCUS - Das moderne Nachrichtenmagazin Nr. 25 vom 20.06.1994 Seite 100 LITERATUR UE Handke in Weimar Im Weimarer Wittumspalais trafen sich einst Goethe, Wieland, Herder und Durchreisende, um ueber grosse Fragenzu diskutieren, ueber AEsthetik, ueber Naturforschung, kurz, ueber die Revolution des Geistes, die sich Ende des 18. Jahrhunderts vollzog. Diesen Ort waehlten der Stifter Hubert Burda, die Juroren Peter Hamm, Peter Handke, Alfred Kolleritsch und Michael Krueger, um in diesem Jahr ihre Poetik-Preise zu verleihen: Den Petrarca-Preis (40 000 Mark) an den Muenchner Filmkritiker Helmut Faerber, den Nicolas-Born-Preis (15 000 Mark) an die in Strassburg lebende Autorin Barbara Honigmann und den Petrarca-UEbersetzer-Preis (15 000 Mark) an Elisabeth Edl und Wolfgang Matz. Kurze Ausschnitte aus der Laudatio Peter Handkes auf Helmut Faerber: Beim Lesen bin ich ihm zuerst begegnet als einem Filmkritiker. Etwa Mitte der sechziger Jahre in der Sueddeutschen Zeitung oder in der Monatszeitschrift »FilmkritiK«. Zu Filmen, gleich welchen, eine solch feine und zugleich so bodenstaendige Sprache zu Gesicht zu bekommen, und das auch noch in einer Tageszeitung, das hat mich damals wachgestossen. Oft waren es nur ein paar Zeilen im Lokalfeuilleton . . . Seine hoechst eigene Intelligenz galt hauptsaechlich den Dingen, denen er zugeneigt war. Sein Scharfsinn ist insbesondere einer, der aus dem Enthusiasmus kommt. Hand in Hand mit diesem Schreiben geht diese spezifisch Faerbersche Melodie. Die Bildhaftigkeit, die Gegenstaendlichkeit. Helmut Faerber ist ein maerchenhafter Filmkritiker - und Satz fuer Satz auch noch etwas anderes. Umgekehrt hat er bei all den Filmen und Autoren, die er erfreut begruesste - freudiges, sachgerechtes Begruessen, so koennte der gemeinsame Nenner seiner Artikel heissen - kein Mal das Mass verlassen, ist nie durch UEberschwang unglaubwuerdig, bleibt immer zugleich der nuechterne Kritiker. Dass ein Werk sich sehen laesst, macht fuer ihn erst seine Kritikwuerdigkeit aus. Aber die Zeitumstaende muessen in der Betrachtung dabeisein . . . Kritik ist fuer ihn Verstehen und Historie . . . In der Art des Gewichtens ist Faerber eher der Bruder Walter Benjamins. Ebenso in dem fragmentarischen Charakter und ebenso in dem anmutigen Einssein von Begrifflichkeit und Anschauung . . . Faerbers Sprache kommt mir noch vollkommener vor, ehrlicher und luftiger, nicht nur wegen seiner Abstammung aus Regensburg, sondern wegen seiner Abstammung von Karl Valentin. PETRARCA-PREIS 1994 © Focus Verlag und Redaktion Bildunterschrift: HELMUT FAERBER bei seiner Danksagung.Jurymitglied Alfred Kolleritsch; PETER HANDKE verliest seine Lau-datio.Preisstifter Dr.Hubert Burda Hauptthemen: Kultur; Kunst; Literatur Nebenthemen: Kultur Kulturelles Kulturpreise Schlagworte: Weimar Petrarca-Preis 1994 Preistraeger Laudatio Auszug Namen: Peter Handke Helmut Faerber Barbara Honigmann Elisabeth Edl Wolfgang Matz Land: Bundesrepublik Deutschland BR FOCUS Dokumentennummer: 0694203546
|
|
|
carpe librum -- suchen -- buchkauf
Peter Handke
VERSUCH UEBER DEN GEGLUECKTEN TAG
Ein Wintertagtraum
Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1991, 90 S., ISBN: 3-518-40379-6
VERSUCH UEBER EINEN GEGLUECKTEN TAG nennt P.H. seinen nunmehr dritten Versuch, den er auch noch mit ein Wintertagtraum entschuldigen moechte.
..erkenne ich doch immer oefter, und mit immer groesseren Zorn, gegen mich selber, wie mit der vorrueckenden Zeit mehr und mehr Augenblicke meiner Tage mir etwas sagen, wie ich aber weniger und weniger von ihnen fasse und, vor allem, wuerdige.
Diesem unserer Zeit und unseren Breitengraden durchaus angemessenen Motiv kommt und kommt P.H. aber nicht auf die Spur, benennt es auch erst auf der Seite 68, um es allerdings sogleich in niederschmetternder Weise wieder zu negieren:
Ich bin, ich muss es wiederholen, empoert ueber mich, dass ich unfaehig bin, das Licht des Morgens am Horizont, welches mich gerade noch hat aufblicken und zur Ruhe kommen lassen (in die Ruhe kommen, steht beim Briefschreiber Paulus), zu halten.
Tatae, Tatae, Tatae!
Auch ein Versuch verlangt in seinem Tasten nach Stringenz, und wenn die dem Autor nicht moeglich ist, weil er zu keiner ihn befriedigenden Loesung kommt und er zuletzt den Traum lediglich als Traum anerkennt, dann haette das Publikum fuer sein Geld wenigstens einige gelungene Fragmente verdient. Aber dieser Wintertagtraum kommt unverdaut und unueberarbeitet ueber die gutwillige Leserschaft: Dynamisch-inhaltliche Widersprueche sind von P.H. unkommentiert neben-und nacheinander hingerotzt, will sagen, angetastet worden. Sie ergeben kurze, ihrer selbst wegen, hingeworfene Assoziationsstrecken, die ins beliebige Irgendwohin weisen und alles Moegliche, nur keinen wirkungsvollen und glaubwuerdigen Bezug zur Welt, zum Leser, zum Thema oder auch nur zum Autor herstellen.
Neben dem wortwoertlichen UEbersetzen franzoesischer Idiome, wurden P.H. offenbar auch wortwoertliche UEbersetzungen von Paulustexten aus dem Alt-Griechischen zur ebenfalls von ihm unbegruendeten Autoritaet. Aber die wortwoertliche UEbersetzung schuetzt nicht vor Missverstaendnissen und Nicht-Verstehen. Auf P.H.s Und es entspraeche der Idee solch eines Tages, statt eines Versuchs, eher die Psalmenform, ein wohl im voraus vergebliches Flehen?, haette ihm selbst Paulus ein heftiges, verzweifeltes Das wohl nicht! entgegengeschleudert und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass nur sein Innewohnen in der Dialektik des Psalmes ihm auch den von P.H. an den Anfang gestellten Vers an die Roemer eingegeben hat: Der den Tag denkt, denkt dem Herrn!
Wer sich und andere so wenig ernstnimmt, musste das Thema zweifach verfehlen, auch wenn Bemaentelungen wie Versuch und Traum als Amulette dagegengehalten wurden: Sein offenbar blindgepicktes Korn auf Seite 68 wollte P.H. nicht schlucken, dafuer haelt er sich spitzfindig, was P.H. wohl mit aesthetisch verwechselt, an der naiven Suche nach einem absoluten Rezept fuer planbar geglueckte Tage auf, aehnlich wie andere nach Wunschtraumfrauen oder -maennern Ausschau halten, weil sie sich nicht auf eine spannungsvolle Beziehung einzulassen vermoegen.
Dieses Buch ist noch nicht mal langweilig, es ist mit seinen ueberlangen, selbstgefaelligen Wortspielereien in beleidigend schlechter Verfassung. Nur P.H. kann wissen, warum er es nicht in die Schublade fuer fehlgeschlagene Versuche geraeumt hat:
Ich selber bin mein Feind geworden, zerstoere mir das Licht des Tags; zerstoere mir die Liebe; zerstoere mir das Buch.
Ulrich Karger
carpe librum ist ein Projekt von carpe.com/DELOS AG- und by Sabine und Oliver Gassner, 1998, 1999, 2000ff. - Das der Texte liegt bei den RezensentInnen. Wir vermitteln Texte in ihrem Auftrag.-mailto:librum@carpe.com
|
|
|
VIE SANS POESIE
(...)
Dans les journaux tout etait deja noir sur blanc
et tout phenomene d'avance m'apparaissait
comme un concept.
Il n'y avait plus que dans les pages culturelles des journaux qu'on
vous invitait a mettre les concepts en =uvre,
mais les efforts des redacteurs
n'etaient qu'une danse d'ombres devant d'autres ombres dansantes.
Il fallait que les romans soient =violents= et que les poemes soient des =actions=.
Des mercenaires s'etaient egares dans la langue et occupaient tous les
mots, s'oppressaient les uns les autres
en utilisant les concepts comme mots de passe
et moi, la parole me manquait toujours plus.
(...)
P.H.
Extrait de =Vie sans poesie= in Le Non-Sens et le Bonheur, Poemes,
Christian Bourgois Ed., 1975. Traduction de G.A. Goldschmidt
Pour ecrire la seule envie ne suffit pas : il faut que s'y ajoute la detresse
P. Handke, Images du recommencement,
Paris, Ch. Bourgois 1987
Je n'ai pas un seul jour sans une epouvantable oppression ; elle peut durer deux minutes ou deux heures. Cette oppression ne vient nullement d'une quelconque melancolie endogene, elle vient de l'exterieur, et aussi du sentiment de faire quelque chose qui ne concerne plus personne.
P.H. entretien avec H. Gamper in Espaces Intermediaires,
Paris, C. Bourgois
Propos oraux
Je ne peux trouver de formes nettes pour ma vie ni pour mon ecriture au sein desquelles les definir parce que je ne trouve pas de forme pour vivre, parce que je trouve mensonger de vouloir trouver une harmonie par des formes de vie ou des formes d'ecriture. C'est la raison pour laquelle je ne peux emettre comme ca des lois litteraires fermes, tout cela est fortement lie chez moi parce que mon incapacite (que je n'aimerais pas voir designee comme une incapacite negative) a vivre selon des concepts fermes correspond a mon incapacite ou plutpt a ma capacite, a ne pas ecrire avec des concepts.
Mon incapacite a vivre au sein d'un systeme je l'ai elaboree, travaillee pour faire d'elle la capacite a ne pas vivre au sein d'un systeme. Ceci est un paradoxe mais de ce paradoxe precisement est nee la litterature. Tel est le royaume enchante de la litterature : faire de l'incapacite a vivre au sein d'un systeme determine la capacite de ne pas vivre selon un systeme.
Propos oraux inedits
recueillis le 7 juillet 1974 et traduits
par Georges-Arthur Goldschmidt in Austriaca n 16
Il fut si longtemps hors d'etat de parler que lorsqu'il arriva tout de meme a se frayer un chemin jusqu'a la parole cela devint un sermon (et c'etait tres bien ainsi)
P.H. in L'Histoire du crayon, Paris,
Gallimard 1982.
Traduction de G.A. Goldschmidt (...)
Longtemps, LA LITTERATURE a ete pour moi le moyen, si ce n'est d'y voir clair en moi, du moins d'y voir tout de meme plus clair. Elle m'a aide a reconnaitre que j'etais la, que j'etais au monde. J'avais certes deja pris conscience de moi-meme avant de m'occuper de litterature, mais c'est seulement la litterature qui m'a montre que cette conscience n'etait ni un cas unique, ni un cas, ni une maladie.
(...)
Depuis que j'ai reconnu quel etait pour moi l'enjeu de la litterature, aussi bien en tant qu'auteur que lecteur, je suis devenu attentif et critique envers la litterature meme, elle qui fait partie sans aucun doute de la realite. (...) J'attends de la litterature un eclatement de toutes les images du monde apparemment definitives. Et parce que j'ai realise que j'ai pu moi-meme changer grace a la litterature, (...) je suis convaincu aussi de pouvoir changer d'autres gens grace a ma litterature. Kleist, Flaubert, Dostoievski, Kafka, Faulkner, Robbe-Grillet ont change ma conscience du monde. Aussi bien en tant qu'auteur que lecteur, les possibilites connues de decrire le monde ne me suffisent plus. (...)
En general, il s'avere qu'UNE METHODE ARTISTIQUE se degrade de plus en plus au fil du temps lorsqu'on l'utilise de facon repetee. Elle finit par etre un automatisme total de l'art ordinaire, comme des arts decoratifs, de la publicite et de la communication. (...) Il ne s'agit pas pour moi de creer sans methode a partir de la vie, mais au contraire de trouver des methodes. Il est bien connu que c'est la vie qui ecrit le mieux les histoires, sauf qu'elle ne sait pas ecrire. (...)
La vraie vie sait qu'elle est la vraie. La vie fausse ne sait (plus) en regle generale qu'elle est la fausse
P.H. in l'Histoire du crayon
Articles
La fiction, l'invention d'un evenement comme vehicule destine a m'informer sur le monde n'est plus utile, elle n'est plus qu'un obstacle. D'une maniere generale, le progres de la litterature me parat consister en une elimination progressive des fictions inutiles. (...) Auteur, il ne m'interesse d'ailleurs ni de montrer ni de matriser la realite, ce qui m'importe, c'est de montrer (pas de matriser) ma realite. (...)
Il est vrai qu'une certaine conception normative de la litterature designe d'une belle expression ceux qui se refusent encore a raconter des histoires, tout en etant a la recherche de methodes nouvelles pour decrire le monde et pour les experimenter sur lui : elle dit qu'ils =habitent une tour d'ivoire= et les traite de =formalistes=, =d'esthetes=. Soit, je veux bien qu'on dise que j'habite une tour d'ivoire. (...)
J'ai ete encore une fois tres abstrait, j'ai omis de citer les methodes avec lesquelles moi, je travaille (je ne peux parler que de mes propres methodes). Avant tout, c'est la methode qui m'importe. Je n'ai pas de sujets favoris d'ecriture, je n'ai qu'un seul sujet : y voir clair, plus clair en moi-meme, apprendre a me connaitre ou pas, apprendre ce que je fais de travers, ce que je pense de travers, ce que je pense sans reflechir, ce que je dis sans reflechir, ce que je dis par automatisme, ce que d'autres aussi font, pensent, disent sans reflechir : devenir attentif et rendre attentif, rendre et devenir plus sensible, plus receptif, plus precis, pour que moi et d'autres puissions exister aussi de maniere plus precise et plus sensible, pour que je puisse m'entendre mieux avec d'autres et avoir avec eux de meilleures relations. (...)
Texte francais : Dominique Petit
Extrait de J'habite une tour d'ivoire
chap. =J'habite une tour d'ivoire= (c)
Christian Bourgois, 1992
|
|
|
|
Neue Zuercher Zeitung vom 27.02.1999 FEUILLETON / Literatur und Kunst Hassen Sie sich? Bei Schriftstellern zu Haus - Photographien und Gespraeche koeh. Es ist etwas Scheussliches, das Leben! sagt Peter Bichsel; andererseits stellt er sich auch den Himmel graesslich vor: ohne AErger, Depressionen, Rotwein und Langeweile. Wo er seinen AErger hat, ist er zu Hause: in Solothurn, und das nun schon die groesste Zeit seines Lebens. Die Photographin Herlinde Koelbl hat ihn dort besucht und gefragt, womit und warum er schreibe und ob er nicht lieber tot waere. Das hat sie noch andre gefragt, so unbefangen, und ist damit erstaunlich weit gekommen: 22 Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben ihr die Tuer zu ihrem Heiligsten geoeffnet; sogar Peter Handke hat seine Pariser Waldeinsamkeit stilvoll ins Bild ruecken lassen. Von Jurek Becker bis Christoph Ransmayr, von Ernst Juenger bis Herta Mueller, von Elfriede Jelinek bis Durs Gruenbein, von der Dichterklause des Hermann Lenz bis zu Friederike Mayroeckers unvorstellbarer Zimmerumgebung= ohne Scheu und meistens unpraetentioes haben die Autorinnen und Autoren der Photographin ihre Haende, Haustiere und privaten Devotionalien vors Objektiv gerueckt; nur Robert Schneider - = = ich habe mir ein Zuhause fuer meinen Schmerz geschaffen= =- posiert halbnackt in seidenen Kissen als Venus Bruder. Leere Raeume und volle Aschenbecher, das Kirchlein vorm Fenster und die Steuerakten im Schrank - natuerlich kann man sofort erkennen, dass Interieur und Schrift, Geschmack und Charakter, kurz: Text und Person sich mehr entsprechen, als vielen Schriftstellern lieb ist. Man sieht ja ohnehin sehr gerne, wie andere wohnen, und macht sich schnell einen Reim auf den Blumentopf und das Sofakissen, den Lampenschirm und die Buecherordnung, den Teddybaeren und seinen Besitzer. Bei Schriftstellern, die unsere Phantasie bewohnen, rueckt der Blick ins Privatgemach den Dichter eher ein Stueck in die Ferne - er wird nun ganz und gar Person: ein Fremder. Herlinde Koelbl muss es anders gegangen sein; als Photographin ist sie diskret, als Gespraechspartnerin rueckt sie den Portraetierten mit ihren Fragen ungeniert auf den Leib. Warum schreiben Sie, wer waren Ihre Vorbilder, haben Sie Angst vor dem Alter, wie stehts mit dem Tod, denken Sie, dass Frauen die Staerkeren sind, ist Ihr Schreiben autobiographisch gepraegt, finden Sie den ersten Satz leicht, hassen Sie sich, sind Sie ein unvertraeglicher Mensch - wer so naiv und ohne Hemmungen fragt, bekommt weitreichende Antworten; nur Enzensberger blieb wortkarg und kuehl wie sein Aktenschrank. Hans-Joachim Schaedlich sagt gleich, es sei uninteressant, mit ihm zu reden, und Martin Walser schafft es trotz rhetorisch ausgefuchster = =Mitteilungsabstinenz doch nicht ganz, gar nichts von sich zu sagen - es ist eben = =nichts ohne sein Gegenteil wahr= Wahr ist auch, was Peter Bichsel der Interviewerin mit auf den Weg gibt: = =Das, was Sie an dem Gespraech interessiert, interessiert mich als Frage genauso. Nur moechte ich die Antwort nicht wissen.= Doch auch wenn Schriftsteller Leute sind, denen mehr an den Fragen als an den Antworten liegt, widerlegt dieser schoen gestaltete Band auch aesthetisch Enzensbergers Bescheid: = =Persoenlich sind viele Autoren ausgemachte Langweiler.= Da muss Frau Koelbl Glueck gehabt haben. Herlinde Koelbl: Im Schreiben zu Haus.Wie Schriftsteller zu Werke gehen.Photographien und Gespraeche.Knesebeck-Verlag, Muenchen 1998. 260 S., 248 Abb., Fr. 98.-. Autor: koeh Fussnoten: Herlinde Koelbl: Im Schreiben zu Haus.Wie Schriftsteller zu Werke gehen. Photographien und Gespraeche.Knesebeck-Verlag, Muenchen 1998. 260 S., 248 Abb., Fr. 98.-. Datenbank NZZ Dokumentnummer 0299270123
Dokument 3 von 6
Neue Zuercher Zeitung vom 17.08.1996 FEUILLETON / Literatur und Kunst Apologie der Langsamkeit Wozu noch Literatur? UEber Dichtung und Leben Von Gerhard Kaiser Wir sind Zeitgenossen der elektronischen Medienrevolution. Trotzdem werden immer mehr Buecher gedruckt, die freilich immer weniger Leser finden. Das weckt Fragen: Was ist die eigentuemlich literarische Weise, Leben darzustellen? Was kann Literatur im Leben der Menschen heute noch bewirken? Literatur, Theater, Film, Hoerspiel wenden sich an den ganzen Menschen, sogar wenn sie an die Ganzheit des Menschen nicht glauben. Das unterscheidet sie von Theorie, Kommentar und Sachinformation, die exklusiv den Intellekt ansprechen. = = ducation sentimentale= » - der Titel des beruehmten Romans von Gustave Flaubert - koennte ueber den Kunstwerken ueberhaupt stehen. Im umfassenden Umgang auch unseres Unbewussten mit den Werken bildet sich eine spezifische Wahrnehmungsweise aus, die aesthetische - ein Sinn fuer Proportionen und Balance, fuer klangliche, optische, metaphorische Entsprechungen und Botschaften, fuer Ober-, Unter- und Zwischentoene, fuer Rhythmus und Klangfarben, fuer Nuancen. Wir trainieren uns, vielschichtig zu rezipieren - die Verweisungsspiele, wechselseitigen Spiegelungen und Erhellungen, die Relativierung und gegenseitige Bestreitung, die Vernetzung der Symbole und die aussagekraeftigen Stoerungen ihres Gefueges. In dieser Hinsicht kann ein Kinofilm, kann auch Jazz- oder Rockmusik genauso diffizil und beziehungsreich, von gleicher Weltentwurfskraft sein, wie es die Produkte der klassischen Kuenste sind. Es gibt nun aber eine spezifische Wirkungsweise der Literatur, derentwegen es schmerzlich und bedenklich ist, dass sie in unseren Tagen durch andere Medien zurueckgedraengt wird. Literatur ist Sprachkunst, und nirgends ist der Mensch so sehr Mensch wie in der Sprache und durch sie. Der Mensch ist sich seiner selbst bewusst; das heisst, wir sind Zuschauer unser selbst. Das gibt uns nicht nur Distanz, sondern auch Intensitaet. Wir leben nicht nur, wir er-leben. Die vermittelte Unmittelbarkeit des Menschen, seine Intensitaet durch Distanz, kommt zum Hoehepunkt in und durch Sprache. Sie kann das raeumlich und zeitlich Entfernteste, ja das nur Vorstellbare und Denkbare, in einzigartiger Reichhaltigkeit und schwebender Eindringlichkeit herbeiziehen und in unzaehlige Verknuepfungen mit dem bringen, was wir aus der andraengenden Gegenwart ins Bewusstsein und in Worte heben. Sie gibt dem Abwesenden und dem Imaginativen eine vermittelte Weise der Anwesenheit, dem Abstrakten Vorstellbarkeit oder zumindest Deutlichkeit. Sie gibt dem Fluechtigsten eine Art von Dauer. Sie oeffnet den Schacht der Individualitaet zur Mittelbarkeit. Umgekehrt rueckt die Sprache das unmittelbar Gegenwaertige und Andraengende in einen Abstand, der allein in dessen Benennung, in der UEbersetzung von Praesenz ins Zeichen liegt. Und genau das ist es, worin Dichtung in besonderer Weise einuebt, denn in der Dichtung und nur in ihr erscheint Sprache in ihrer Kraft und Vollmacht, kommen alle Moeglichkeiten der Sprache, ihre begrifflichen und nichtbegrifflichen, aber an die Begrifflichkeit gebundenen wie Rhythmus und Klanglichkeit, zum Schwingen. Sie ist sensuell und intellektuell zugleich und der zentrale Traeger des dem Menschen eigentuemlichen selbstreflexiven Weltverhaeltnisses. Alle anderen Kuenste beruhen auf der Direktheit sinnlicher Eindruecke, die freilich in mannigfacher Weise bearbeitet und sublimiert werden, sie gruenden in Klang, Farbe, Form, Volumen, Bewegung. Die Dichtung beruht auf Zeichen, die nur durch eigene Produktivitaet des Rezipienten ueberhaupt ihr Sprechendes freigeben. Unsere Einbildungskraft, unsere Intelligenz, unser Assoziationsvermoegen, unsere Faehigkeit zu sinnenhaftem Vorstellen erst lassen aus Buchstaben oder Lauten Figuren, Handlungen, Raeume, Landschaften aufsteigen. Kein Rezipient von Kunst ist so sehr Produzent wie der Leser. Umgekehrt schuetzt die Begrifflichkeit und Zeichenhaftigkeit der Sprache den Leser vor dem Versinken in distanzloser Unmittelbarkeit und Innerlichkeit. Auch in dieser Hinsicht ist literarisches Lesen eine ganz besondere Weise von Produktivitaet, von kommunikativer Distanznahme, die menschliche Teilhabe allererst begruendet. Jeder Leser ist fuer sich, fern allen mit Recht so verdaechtigen Kollektivraeuschen; aber kein Leser ist mit sich allein, denn das Kommunikationsmedium Sprache haelt ihn im Raum aller. Literarische Lektuere ist so eine besonders menschliche Taetigkeit, weil sie uns zentral in dem in Anspruch nimmt, was den Menschen auszeichnet: Gegenwaertiges in Zeichen zu uebersetzen, aus Zeichen Gegenwart zu gewinnen. Der Film in der Raschheit seiner Ablaeufe traegt tendenziell zur Verfluechtigung der Eindruecke, zu der Bilderflucht des televisionaeren Environments bei, das uns heute immer dichter umstellt. Boris Pasternaks Dr. Schiwago in zwei Kinostunden oder in, sagen wir, vierzehntaegiger, immer wieder in unsere Alltagsablaeufe eingesenkter Lektuere - das hinterlaesst verschiedenartige und auch verschieden tiefe Spuren. Der Kinoeindruck mag zwingender sein; der Lektuereeindruck ist gelassener und hat mehr Zeit, sich mit unserem eigenen Leben zu verweben, sich in unserem Denken zur Geltung zu bringen und einzunisten. Einzig das Lesen zieht uns in die Darstellung von Ablaeufen hinein, ohne uns ihrem Fluss zu unterwerfen. Lesen ist eine Rezeptionsweise, die mit dem Vorgang mitgeht, aber sich zugleich quer zum Dahineilen des Geschehens stellen kann. Das Buch ermoeglicht die = =Entdeckung der Langsamkeit und deren Bewahrung noch in der Rasanz der Vorgaenge; wir koennen lesend langsam eilen. Auch deshalb ist der Romantitel von Sten Nadolny so suggestiv, weil er, ueber die Lebensgeschichte der Romanhelden hinausgreifend, das generelle Angebot von Lektuere mit benennt. Lesen reizt zum Vor- und Zuruecktasten, Vor- und Zuruecklesen, zum Auffalten der horizontalen Linearitaet der Vorgaenge in die Vertikalitaet. Sie besteht in der Bedeutungsaufladung, Motivationsueberschichtung sowie wechselseitigen Bestrahlung und Perspektivierung des = =Vorher= und = =Nachher= Graf Wronskis Fehlbewegung beim Springreiten vor den Augen der hoefisch-aristokratischen Gesellschaft von Petersburg, wobei er der von ihm geliebten und ihm blindlings vertrauenden, vom Erzaehler mit erotisch gesteigerter Sensibilitaet geschilderten Stute Frou-Frou das Rueckgrat bricht: dieser Wendepunkt von Tolstois Roman Anna Karenina verlangt eine von hier ausgehende Vor- und Ruecklektuere der Szenen einer beseligenden und vernichtenden Liebesverblendung. Die minuzioese Schilderung des Rittes und Sturzes fuellt nachtraeglich symbolisch die pragmatische Luecke in der Erzaehlung, die sich als Luecke im Schriftbild - zwei Leerzeilen - kenntlich macht. Sie findet sich an entscheidender Stelle des Romans: wo von der ersten Liebesvereinigung von Anna und Wronski zu erzaehlen waere. Derart ist tendenziell in der Kontinuitaet der Lektuere eine Punktualitaet der Vertiefungen angelegt. Sie loesen kreisfoermig sich ausbreitende, einander ueberschneidende Wellenbewegungen in unserem gesamthaften Leseeindruck aus, wie Steine, die ins Wasser fallen. Damit die Behauptung der Mehrdimensionalitaet des Lesens nicht zu grossraeumig bleibt, moechte ich fuer die eigentuemliche Multivalenz der literarischen Texte auf die fuenf Saetze eines Notats von Peter Handke zurueckgreifen: = =Im Strassengraben war eine Wasserlache, in der die Wolken zogen und der blaue Himmel war.= =Hier veranlassen uns Folgen von sechsundzwanzig abstrakten und konventionellen Zeichen des Alphabets dazu, imaginativ ein Erfahrungsbild in sensuellem Glanz hervorzurufen, in dem doch schon symbolische Bedeutungen von Ganzheit anklingen - Ruhe und Bewegung, Ganzheit als Spiegelung von oben und unten ineinander. = =Ein paar Schneeflocken fielen in die Lache und trieben auf ihr, ohne zu schmelzen.= =Das koennen wir uns zwar sinnlich vorstellen, aber es widerspricht der Erfahrung. Schneeflocken, die auf Wasser fallen, schmelzen. Der folgende Satz deutet (und ich empfinde ihn eigentlich als ueberfluessig): = =Die Zeit verging auf einmal nicht mehr.= =Das Nichtschmelzen der Schneeflocken bedeutet Anhalten der Zeit, Verewigung des Augenblicks. = =War das ein Traum oder die Erloesung?= =Warum Anhalten der Zeit als Erloesung erlebt werden kann, beduerfte einer Erlaeuterung, die hier nicht am Platz ist. Worauf es an dieser Stelle ankommt, ist die logische Alternative: unverbindlicher Traum oder verbindliche Wirklichkeit eines Heilsgeschehens. Der letzte Satz, statt argumentativ diese Alternative zu entwickeln, entfaltet ein Sprachspiel, das die Alternative ins Bodenlose sinken laesst: = =Im Traum erlebte ich es als Erloesung.= =Also: Es war nur eine getraeumte Erloesung. Nein, auch das Gegenteil gilt: Es war zwar nur ein Traum, aber im Traum war es fuer mich die Erloesung. So etwas kann kein Kino. Und so etwas kann auch kein Codesystem, kein Schaltplan, keine mathematische Formel. Wenn extremistische Medienwissenschafter heute Schreiben, Lesen und Verstehen zu veralteten Kulturtechniken erklaeren, weil ihre Eindeutigkeit und UEberpruefbarkeit angeblich zu gering sind, so formulieren sie das negativ, was ich positiv als Reichtum formuliere. Was nicht exakt fassbar ist, was wir nicht in die Hand bekommen, ist nicht ein diffuser Restbestand, der vernachlaessigt werden kann. Es ist der Grund, wo wir stehen, ohne dass wir uns unter die Fusssohlen sehen koennten. Unser Bewusstsein kann unserem vorhergehenden Dasein nur nachtasten, und die feinsten, bis ins Halblicht reichenden Tentakel dafuer sind die der Dichtung. Die exakten Daten der elektronischen Medien funktionieren nur innerhalb der Definitionsrahmen, die durch Sprache und Verstehen erst ermoeglicht und unterfangen werden. Das haben sie mit dem naturwissenschaftlichen Denken, dem sie gemaess sind, gemein. Kein Codesystem, ueber das man sich nicht zuvor verstaendigen muesste, kein Operieren mit Daten und Formeln, ohne dass der Erfassende sich vorher in einer durch Erfahrung verstandenen Lebenswelt situiert weiss. Keine Datenerfassung, ohne dass der Erfassende verstanden haette, dass es sich da um Daten handelt. Sogar fuer Schreiben und Lesen gilt: Verstuenden wir nicht, dass Spuren Schrift sein koennen, niemand wuerde sie als Schrift lesen. Und wenn ein Computer aus Wiederholungen, Haeufigkeiten, Verteilung und anderen Merkmalen den Schriftcharakter von Spuren erschliessen kann, dann nur, weil ein Mensch ihn konstruiert und programmiert hat, der weiss, dass es Schrift gibt und was sie an Kennzeichen aufweist. Nicht nur historisch, auch grundsaetzlich gilt: ohne das sprachliche Weltverhaeltnis des Menschen mit allen Unexaktheiten und in der Fuelle seiner Zugriffsmoeglichkeiten gaebe es keine exakten Datensprachen. Sie sind eingegrenzte Sonderareale im Universum der Sprache im Gegensatz zur Dichtung, der Konzentrationssphaere aller sprachlichen Potenzen. KS Kasten: Addio? koeh. = =Die Furie des Verschwindens= =hat Hans Magnus Enzensberger Anfang der achtziger Jahre einen Gedichtband genannt: Hegels Metapher ist nicht umsonst zur Allegorie unserer Zeit avanciert. Das Verloeschen der Schrift, die Erosion der Koerper, die Fluktuation der Bilder - die Entmaterialisierung der Zeichen ist auch in den Kuensten ein vorrangiges Thema. Gemeinhin wird gerne das Bild gegen die Schrift, werden die Neuen Medien gegen das gute alte Buch ausgespielt. Doch die Furie des Verschwindens macht auch vor den Bildern selber nicht halt. Die grossen Gesten des Abschieds und die Begraebnisrituale der Theoretiker sind laengst inflationaer geworden - waehrend die Kuenste selber mit ihrem Ende ganz gut leben koennen. Dennoch: Was geht uns verloren, wenn wir nicht mehr lesen, wenn unser sprachliches Weltverhaeltnis den visuellen Beschleunigungen nicht standhaelt? Und was geschieht, wenn die Relation der Bilder zum Sichtbaren, zur Realitaet ausserhalb ihrer selbst aufgekuendigt wird - und das auf der Leinwand gezeigte nur mehr aus den Derivaten des Virtuellen, den Trickkisten der Simulation stammt? Wir drucken hier drei Beitraege, die zeigen, dass das Gedaechtnis der Worte und Bilder nicht nur eine Frage sich wandelnder Datentraeger ist, sondern unser Verhaeltnis zur Zeit, die ja immer auch unsere Lebenszeit ist, ueberhaupt betrifft: Es geht, schon heute, um die prekaere Zukunft des Erinnerns. Autor: AA Datenbank NZZ Dokumentnummer 0896170098
<
<
Neue Zuercher Zeitung vom 30.10.1999 FEUILLETON / Literatur und Kunst UEber die Fluesse, in die Sprachen Georges-Arthur Goldschmidt ueber Freud und sich selbst Von Juergen Ritte Im dichtbesiedelten deutsch-franzoesischen Milieu ist kein Fall bekannt, der wie Georges-Arthur Goldschmidt in beide Sprachen uebersetzt und sich in beiden Sprachen als Schriftsteller von Rang etabliert hat. Der in Paris lebende Autor nimmt an diesem Wochenende den Ludwig-Boerne-Preis fuer Essayistik entgegen. Paris, 21. Oktober 1999. Es ist ein etwas zu warmer Nachmittag im Herbst. Der Himmel ueber Paris changiert in allen Grautoenen, spielt hier und da ins Weisse, ins Pastellblaue und sprenkelt fluechtig die Passanten. Kein Grund, den Regenschirm aufzuspannen. Seit einem guten halben Jahrhundert beobachtet Georges-Arthur Goldschmidt diesen Himmel, der sein Himmel, sein Dach ueber dem Kopf geworden ist. Von seinem Domizil in Belleville, vom sogenannten = =Telegraphenhuegel= =aus, hat man an manchen Stellen einen unverstellten Blick auf das steinerne Meer von Paris und den weitgespannten Himmel der Ile-de-France mit seinem unvergleichlichen Licht, einem Licht, das vom nahen, vom wirklichen Meer zu kuenden scheint. Und wie das Meer ist dieser Himmel in steter Bewegung, stets der gleiche, nie derselbe. Er = =nehmet . . . und giebt Gedaechtniss= =¬=wie Hoelderlin es auf der Reise nach Bordeaux angesichts der meerbreiten Garonne von der nahen See vermutete. Immer wieder hat Georges-Arthur Goldschmidt in seinen autobiographisch inspirierten Erzaehlungen, der = =Absonderung= =etwa oder dem = =Unterbrochenen Wald= =(beide 1991 erschienen), einen Ausguck bestiegen und den Himmel, den Horizont befragt, dabei den = =Blick in eine so weite Gegend= =gerichtet, = =dass die vollstaendige Vergangenheit aufersteht, schluchzergleich= =¬=UEBER DIE FLUESSE An diesem warmen Herbstnachmittag im Oktober begleite ich Georges-Arthur Goldschmidt vom rechten aufs linke Seine-Ufer: Pont au Change, Ile de la Cite=¬==, Pont Saint-Michel. Zweimal ueberqueren wir den Fluss, der nach Westen, zum Meer hin, stroemt, zweimal treten die Haeuser und Palaeste zurueck und geben den Blick auf andere Bruecken frei. Gerade ist in Frankreich Georges-Arthur Goldschmidts Autobiographie erschienen. Sie liegt noch druckfrisch auf den Praesentiertischen der Buchhaendler. = =La travers =¬==e des fleuves= =¬=die UEberquerung der Fluesse, oder besser: = =UEber die Fluesse= =¬=so lautet ihr Titel. Die Fluesse: da ist die Elbe, da ist die Seine, dazwischen der Rhein und, weiter weg, der Arno. Es sind diese Fluesse, die die sentimentale Geographie des Georges-Arthur Goldschmidt umspuelen und sich in der weiten Gegend des Himmels ueber ihm spiegeln. Die Fluesse zeigen den Weg in die Vergangenheit. Auch an diesem Oktobertag ueberquert Georges-Arthur Goldschmidt einen Fluss, um der Vergangenheit einen Besuch abzustatten. Im = =Couvent des Cordeliers= =an der Rue de lEcole de M =¬==decine wird am fruehen Abend eine Ausstellung der Kunstsammlung des grossen R=¬==sistant Bernard Anthonioz eroeffnet. Dessen Frau, Genevivede Gaulle-Anthonioz, Nichte des Generals und ebenfalls eine Widerstandskaempferin, hat im letzten Jahr ein kleines, in seiner Einfachheit ueberwaeltigendes Erinnerungsbuch vorgelegt, dessen Titel wie ein vorauseilendes Echo auf Goldschmidts Autobiographie klingt: = =La travers =¬==e de la nuit= =(dt. = =Durch die Nacht= =¬=Sie erzaehlt dort von ihrer Deportation und ihrem zufaelligen UEberleben in dem beruechtigten Frauenlager von Ravensbrueck. Wir sprechen ueber dieses Buch, dann kommen wir noch kurz auf Georges Perec zu sprechen, der im Jahre 1936 dort zur Welt gekommen war, wo Georges-Arthur Goldschmidt jetzt lebt, in Belleville. Perec war das einzige Kind juedischer Einwanderer aus Polen. Sein Vater starb im Juni 1940 als franzoesischer Soldat im Kampf gegen die Deutschen. Ein Jahr spaeter, im Herbst 1941, wird Perec, er ist gerade fuenfeinhalb Jahre alt, von seiner Mutter an der Gare de Lyon in einen Zug Richtung franzoesische Alpen gesetzt, wo er, als kleiner Katholik getarnt und versteckt, ueberleben wird. Die Mutter hat er nie wiedergesehen. Denn auch sie wurde ein weiteres Jahr spaeter in einen Zug gepfercht. Und der fuhr nach Auschwitz. Zuege durch Deutschland, Zuege in die Alpen, nach Savoyen, Zuege, die ueber Fluesse fahren. Der Himmel ueber der Elbe war an diesem Morgen vor nunmehr ueber sechzig Jahren klar, das Licht ohne Schattierungen. Es ist der 18. Mai 1938. Auch der elfjaehrige Georges-Arthur, der damals noch ein deutscher Juergen war, wird, gemeinsam mit dem aelteren Bruder, von seinen Eltern in Hamburg in den Zug gesetzt. Richtung Florenz. Er wird die Eltern nie wiedersehen. Es hilft nichts, dass der Vater, Amtsgerichtsrat aus bester grossbuergerlicher Familie, protestantisch getauft ist, dass er deutschnational und - Republik hin, Nazis her - kaisertreu bis zur Karikatur ist und die Schmisse des Akademikers aus schlagenden Verbindungen noch stolz im Gesicht spazierenfuehrt (er soll Heinrich Mann fuer den = =Untertan= =unfreiwillig Modell gestanden haben): Fuer die netten Nachbarn, die Haendler, den frommen Pastor im heimatlichen Reinbek ist die ganze Familie juedisch. Und fuer die braunen Machthaber erst recht: seit 1933 ist der Vater infolge der = =Gesetze zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums= =arbeitslos. So scheint es dem Richter a. D. angeraten, die Kinder vorlaeufig in Sicherheit zu bringen. Zunaechst an den Arno, zu Freunden. Goldschmidts Autobiographie, die den Lesern seiner Erzaehlungen episodisch vertraut ist, reicht zurueck ins 19. Jahrhundert, in die Zeit der Grosseltern, und fuehrt bis in die deutsche und franzoesische Nachkriegszeit. Sie erzaehlt vom preussisch-autoritaeren Charakter, der zum Untergang der Zivilisation in Deutschland fuehrte, und von der tragischen Verblendung jener, die Deutsche waren und nicht wahrhaben wollten, dass dies nur noch mit Ariernachweis moeglich sein sollte. Sie erzaehlt von einer Schwester, die als Frau eines = =Ariers= =¬=des Philosophen und Husserl-Schuelers Landgrebe, ueberlebt hatte und nach dem Kriege von KZs und Gaskammern so wenig gewusst haben wollte und wissen wollte wie die gesamte bundesrepublikanische = =Kaffeetanten-Gesellschaft= =(Goldschmidt) der Restauration. Und nochmals von einem Vater, der schliesslich nach Theresienstadt deportiert worden war, dort einer protestantischen (!) Gemeinde als Pastor vorstand, dem = =Abtransport= =in die Gaskammern entging und bis zu seinem Tode im Jahre 1947 hartnaeckig glaubte, Opfer eines bedauerlichen Missverstaendnisses gewesen zu sein. Und schliesslich schont Goldschmidt, der sich und den Lesern dieses persoenliche Geschichtsbuch zum 50. Jahrestag seiner Einbuergerung in Frankreich schenkt, andere so wenig wie sich selbst. Anlaesslich einer ersten Wiederbegegnung mit Deutschland, einer Reise nach Hamburg im Jahre 1949 (er ist bereits im Besitz seines franzoesischen Passes), und seines Militaerdienstes in den Jahren 1953/54, der ihn ausgerechnet nach Karlsruhe verschlaegt, skizziert er mit Witz und recht malizioeser Eleganz das Portraet einer Verdraengergesellschaft mitsamt ihren unseligen deutschen Kontinuitaeten. Insbesondere die deutsche Professorenschaft, die sich selbst spaetestens ab 1933 in vorauseilendem Gehorsam gleichgeschaltet hatte und nach 1945 weitermachte im Programm wie gewohnt, wird reichlich bedient. Und unter diesen Professoren vor allem dieser eine, der in erster Linie wohl zu Nutz und Frommen des franzoesischen Lesers (aber nicht nur des franzoesischen!) in seiner ganzen gloriosen Feigheit vorgefuehrt wird: Martin Heidegger, dessen Sprache, wie Goldschmidt meint, schon in = =Sein und Zeit= =nazistisch sei und der fuer seinen alten Lehrer und vaeterlichen Freund Edmund Husserl nicht einen Finger geruehrt hat, als dieser, schon schwer gebrechlich, von den Nazis aus seiner Freiburger Wohnung vertrieben werden sollte. Auch das, so mag sich der junge Goldschmidt gesagt haben, gehoert vielleicht zur grossen Philosophie. Und so pilgerte er in Begleitung von Schwager Landgrebe zum Todtnauberg. Freilich musste er, der ungezogene Bengel, der kein Deutscher mehr sein mochte, draussen bleiben, als der Schwager ins Allerheiligste eintrat. Da aber entwich der Huette ein kleiner weisser Koeter. Vom Donner geruehrt, warf Goldschmidt sich ins Gras. = =Das= =¬=so schrie er in den Schwarzwald hinein, = =ist der Hund des Seins!= =¬=Der Hund des Seins, des Pudels Kern. Auch heute noch, da wir unweit des Seine-Ufers einen Kaffee trinken, ist Goldschmidt sichtlich amuesiert ueber seine damalige = =trouvaille= =¬=Das Tier, das grosse = =Andere= =¬=das unbekuemmert seiner = =Geworfenheit, seines So- oder Daseins und ueberhaupt alles Seienden und Wesenden und Eigentlichen ueber die Wiese trollt, noch dazu womoeglich klaeffend, das ist die Rache Goldschmidts am Philosophen, dem die Schluchzer, von denen die Bahnsteige Europas am 18. Mai 1938 und an jedem anderen Tag widerhallten, offenbar gleichgueltig waren und der auch Jahre spaeter, lange nachdem sich ein Witzbold namens Goldschmidt im Gras vor der Huette gekugelt hatte, nicht ein Wort fand, um die Verzweiflung eines anderen Besuchers aus Paris, der ihn verstehen wollte, ich denke an Paul Celan, zu lindern. Andere Himmel, andere Gewaesser. 1938 fuhr der Zug ueber die Elbe, ueber den Main, ueber die Donau nach Muenchen und weiter nach Florenz. Es wurde ein kurzer Aufenthalt, denn wirklicher Schutz war auch hier nicht laenger gewaehrleistet. Schon ein Jahr spaeter sitzen Georges-Arthur und sein Bruder wieder im Zug. Diesmal gehts nach Savoyen, in die franzoesischen Alpen, wo noch heute juedische Kinder- und Erholungsheime an abgelegeneren Orten von Zeiten zeugen, in denen namenlose Zeugen der Menschlichkeit zahlreichen Kindern Zuflucht boten. Sie konnten nicht alle vor Barbies Meute und ihren franzoesischen Helfershelfern retten, die von Lyon aus ins Gebirge aufbrachen, um Kinder zu jagen und zu fangen. Oft gingen die Schutzengel der Kinder, Bauern, sogenannte -einfache- Leute, Lehrer(innen), freiwillig mit in den sicheren Tod. Auch Goldschmidt hat einen Schutzengel, eine Verwandte, die noch lange aus der Ferne wirken wird, Baronesse Nomie de Rothschild, fuers erste aber fuer seine Unterbringung in einem besseren Internat bei Megve sorgt. Georges-Arthur, der blondgelockte, blauaeugige Junge aus Deutschland, ist bei seinen franzoesischen Mitschuelern nicht beliebt. In seinen Erzaehlungen, vornehmlich in den achtziger und fruehen neunziger Jahren entstanden, hat Goldschmidt diese Zeit wieder heraufbeschworen: die verwirrende Entdeckung der Sexualitaet, die Lust an der Zuechtigung, die Internats-Homosexualitaet, seine pubertaere Inkontinenz, den Onanismus. Erst die Nachricht vom Tod der Mutter, der es immerhin vergoennt blieb, ihrer schweren Krankheit noch 1942 im heimischen Bett zu erliegen, stimmt die strenge Schulleitung etwas milder gegen dieses renitente, zuweilen jaehzornige Kind. Unter dem Himmel, unter den Wolken, an den Baechen der savoyardischen Alpen hat Goldschmidt angefangen, franzoesisch zu sprechen, franzoesisch zu denken. Nach der Befreiung geht er nach Paris, leidet weiter an seiner Fremdheit und traeumt banale Traeume: ein philosophisches, ein literarisches Werk hinterlassen, das der Welt (oder besser noch der Nachwelt) schon zeigen wird, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Nach manchem Studium an der Sorbonne besteht Goldschmidt schliesslich ein Deutschlehrerexamen. Er heiratet, wird franzoesischer Beamter, Vater, Grossvater, wird erwachsen wie ein = =normaler= =Buerger . . . und beginnt dann doch, zaghaft zunaechst (ein Essay ueber den Buchhaendler und Dichter Marcel B =¬==alu erscheint 1966, zwei erste Romane und Versuche ueber =¬mlierre, Rousseau und Nietzsche folgen in den siebziger Jahren), zu schreiben und sein Thema zu finden. Einem groesseren Publikum in Frankreich wird er zunaechst als = =der UEbersetzer von Peter Handke= =bekannt. Eine Leistung uebrigens, die ihm Peter Handke mit einer wahrhaft glaenzenden UEbersetzung des = =Unterbrochenen Waldes= =und einem sehr schoenen Vorwort zur = =Absonderung= =dankte. Gleichzeitig aber horcht Goldschmidt schon = =ganz narzisstisch= =¬=wie er sagt, in sich selbst hinein, unternimmt er so etwas wie eine Archaeologie seiner selbst. Zur Mitte seines Lebens, die heute, im Unterschied zur frueheren Renaissance, weit jenseits der 30 liegt, stieg Goldschmidt als Dante durch die erstaunlichen Kreise seines Innenlebens. = =Wer auch nur einmal ein Krustentier von vorne beobachtet hat= =¬=erklaert mir Goldschmidt, der seinerseits den sublimen Jean-Luc Benoziglio zitiert, = =der kann keinen Zweifel mehr an der Kuriositaet des Lebens hegen.= =Und der Vergil auf dem Weg in die Tiefen, die fuer Goldschmidt durchweg submarine Tiefen sind, wo die sonderbarsten Tiere leben (da ist es wieder: das Meer, das Wasser, die Fluesse), heisst Sigmund Freud. Nein, Goldschmidt hat sich nie im psychoanalytisch verbraemten Kauderwelsch der Selbsterfahrung zu Papier gebracht. Er hat fuer seine Geschichten, die in der Literatur ohne Leitbild dastehen - allenfalls Kafka faellt einem ein -, eine Sprache gefunden, in der die Erinnerung mit der Praezision und der Lichtstaerke eines ploetzlich auf die richtige Bildschaerfe justierten Diapositivs von der Leinwand auf den Betrachter stuerzt. Wieder anders sieht es bei dem UEbersetzer Goldschmidt, bei dem Essayisten aus. Was er mit Freud - und durch Freud hindurch - in den Tiefen auslotet, das sind die Stimmen, die unter den Sprachen sprechen. Man habe sich das Unbewusste, sagte Lacan, wie eine Sprache strukturiert vorzustellen. Aber wie sieht es mit der Tiefenstruktur der Sprachen und des Sprechens aus? Was schwingt mit unter der Oberflaeche der Woerter? Goldschmidt, der nicht nur als UEbersetzer jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, befragt das Unbewusste, das Ungewusste der Sprache. Seine einfache, geradezu kindliche, ans urspruenglich Wortspielende aller in die Sprache Hineinwachsenden erinnernde Frage lautet: Was eigentlich sagt eine Sprache wirklich? WOERTERMEER Solche Art der Sprachbefragung kann, wenn sie nicht wild etymologisierend ins Kraut schiessen will, nur vergleichend vorgehen. Die Grenzen des in einer Sprache Sagbaren werden erst von einer anderen Sprache aufgezeigt. Um diese Grenzen zu spueren, sie zu erkennen, bedarf es der seltenen Gabe zweier = =Mutter= =¬=»sprachen. Im dicht besiedelten deutsch-franzoesischen Milieu ist kein Fall bekannt, der, wie Goldschmidt, in beide Sprachen uebersetzt und sich in beiden Sprachen als Schriftsteller von Rang etabliert hat. Bereits 1988 erschien in Frankreich sein Essay = =Quand Freud voit la mer - Freud et la langue allemande= =¬=der jetzt, bei Ammann, unter dem anekdotisch anmutenden Titel = =Als Freud das Meer sah= =auf deutsch erschienen ist. Es ist dies der erste Teil einer Sprachbewusstmachung, die 1996 mit = =Quand Freud attend le verbe= =fortgesetzt wurde. In beiden Faellen geht es vordergruendig um das, was Freud der deutschen Sprache verdankt, ihrem Woertermeer eben und ihrer Syntax. Und es geht Goldschmidt darum, zu zeigen, wie Freud das Deutsche fuer sich hat arbeiten lassen, wie Psychoanalyse und deutsche Sprache sich gegenseitig erhellen. Doch gehen die zum Teil frappierenden Einsichten Goldschmidts weit ueber Freud hinaus. Im Gegensatz zu landlaeufigen Vorstellungen von franzoesischer = =clart=und dunklen deutschen Tiefen bescheinigt Goldschmidt dem Franzoesischen etwa einen hoeheren Grad an Abstraktion. Das Deutsche hingegen sei eine sehr konkrete, = =leibliche geradezu koerpergebundene Sprache, die sich um einfache Verben wie stehen, liegen, haengen, fallen, sitzen gruppiere, Verben, die stets Bewegung und Stellung des Koerpers im Raum verdeutlichen. Im Franzoesischen ist eine Sache oder Person an irgendeiner Stelle im Raum, im Deutschen liegt, steht oder haengt sie irgendwo. Im Franzoesischen antwortet man auf die Frage: = =Wer ist da?= == =Cest moi= =- und bleibt bei der dritten Person Singular, gleichsam von aussen auf sich selber zeigend, von sich selbst abstrahierend (eine Antwort uebrigens, mit der schon ein Jacques Lacan sich eingehend befasst hat). Das deutsche = =ich= =aber, das im Gegensatz zum franzoesischen = =je= =wohl alleine stehen kann, darf nicht aus sich heraus: ich bins. Zu den Kabinettstuecken im Freud-Essay gehoert zweifellos, was Goldschmidt, ausgehend von der Beschreibung des Falls des Senatspraesidenten Schreber, mit dem Verb = =unterliegen= =treibt. Da geht es vom = =unterlegen sein= =ueber das konkret sexuell gemeinte = =unten liegen= =bis zum guten deutschen = =Untertan= =¬=der sich der Obrigkeit unterwirft und unten liegen will. So = =denkt= =¬=sagt Goldschmidt, sagt Freud, das Deutsche den Zusammenhang von Macht und Sexualitaet. - UEbertreibung? Der Schriftsteller Georges-Arthur Goldschmidt uebersetzt, was die eine und die andere Sprache in ihm sagen. Denn selbstverstaendlich sind die Freud-Essays auch Versuche, in der eigenen Sprachwerkstatt fuer Ordnung zu sorgen und das Material auf seine Tauglichkeit hin zu pruefen. Und es ist kein Zufall, dass Goldschmidt fuer zwei Erzaehlungen wie = =Die Absonderung= =und = =Die Aussetzung= =¬=die sich mit seiner jugendlichen Sexualitaet, mit Unterwerfungsphantasien und Schuldgefuehlen befassen, die deutsche Sprache waehlte. Nachdem ich mich, am anderen Seine-Ufer angelangt, fuer diesen Nachmittag von Georges-Arthur Goldschmidt verabschiedet hatte, bin ich in die Buchhandlung gegangen, um = =La travers=¬==e des fleuves= =zu kaufen. Zwei Tische standen dort. Links die franzoesische Literatur in Neuerscheinungen, rechts neue UEbersetzungen aus allen moeglichen Sprachen. Goldschmidts Buch lag zwischen Stapeln von = = rature =¬== e= =¬=Ein Akt der Absonderung, der Abschiebung ueber die Fluesse zurueck nach Deutschland? Deuten wir diese Fehlleistung, diesen = =acte manque=¬=== =¬=des Buchhaendlers um. Diesmal nicht mit Freud, sondern mit Proust. Jeder Schriftsteller, so sagte dieser, ist im Grunde ein UEbersetzer. Und: Jede Literatur, die diesen Namen verdient, ist in einer Art Fremdsprache geschrieben. Beides weiss wohl niemand besser als Georges-Arthur Goldschmidt. Georges-Arthur Goldschmidt: La e des fleuves.Autobiographie. Le Seuil, Paris 1999. 329 S., fFr. 135.-.Georges-Arthur Goldschmidt: Als Freud das Meer sah.Freud und die deutsche Sprache.Aus dem Franzoesischen von Brigitte Grosse.Ammann-Verlag, Zuerich 1999. 192 S., Fr. 38.-. Autor: rit Fussnoten: Georges-Arthur Goldschmidt: La traverse des fleuves.Autobiographie.Le Seuil, Paris 1999. 329 S., fFr. 135.-. Georges-Arthur Goldschmidt: Als Freud das Meer sah.Freud und die deutsche Sprache.Aus dem Franzoesischen von Brigitte Grosse. Ammann-Verlag, Zuerich 1999. 192 S., Fr. 38.-. Datenbank NZZ Dokumentnummer 1099300084
Dokument 2 von 6
Format 28/99 vom 12.7.1999 Seite 140Ressort: FEU Feuilleton Interview: Jeder Krieg hat einen eigenen Stil Paul Parin ist Psychoanalytiker, Voelkerkundler, Antifaschist, Jugoslawienkenner. Ein Gespraech ueber Freuds Vermaechtnis, die Barbarei auf dem Balkan und Peter Handkes Bilder des Exotischen. Interview: Bert Rebhandl Format: Herr Parin, Sie haben letzte Woche in Wien einen der neu geschaffenen Sigmund-Freud-Preise erhalten. Waren Sie geruehrt? Parin: Alles Mumpitz! Format: Aber weiss nicht gerade Ihr Fach, die Ethnopsychoanalyse, dass jede Gesellschaft Rituale braucht? Parin: Ja, da gaebe es einiges zu erforschen. Die Ethnopsychoanalyse hat sich ja von den traditionsgeleiteten Kulturen auf die eigene, europaeisch-amerikanische verlegt. Aber es ist hier schwieriger, die richtigen Fragen zu stellen. Das Wahrnehmen der Kultur, der man selbst angehoert, ist kompliziert. Man tappt oft in die Vorurteile, die man unbewusst mitbekommen hat. Format: Ein aktuelles Vorurteil besagt, dass Freud und seine Theorien erledigt seien. Parin: Das behaupten viele. Die Psychoanalyse gelte ja nur fuer die buergerlichen Familien im Wien der Jahre 1890 bis 1914. Das stimmt alles nicht. Ich habe einmal den OEdipuskomplex in drei verschiedenen Kulturen beschrieben. UEberall ist er feststellbar, wenn auch mit Unterschieden. Es scheint so zu sein, dass sich ein Kind in der Saeuglingszeit auf die Hauptpflegeperson - meist die Mutter - einstellt. Wenn ein weiterer Mensch dazutritt, geschieht das immer krisenhaft. Diese Krise nennt man OEdipuskomplex. Format: Die umstrittenste Theorie Freuds galt dem Todestrieb. Kann man - nach den grausamen neunziger Jahren - dieser Theorie wieder etwas abgewinnen? Parin: Der Todestrieb gehoert einer anderen Erkenntnisebene an. Freud stand unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges. Der Todestrieb ist eine Spekulation: Dass alle Lebewesen sterben und gleichzeitig unsterblich sind, weil sie sich fortpflanzen. Als journalistisches Kuerzel fuer die Grausamkeiten des Jugoslawienkrieges taugt er nicht. Format: Vielleicht aber als Versuch, die Barbarei zu verstehen? Parin: Die Barbarei? Sehen Sie, der Erste Weltkrieg brach 1914 aus. Es dauerte vierzehn Tage, bis die OEffentlichkeit und die Behoerden in Deutschland ueberzeugt waren, die Englaender seien die barbarischste Nation der Welt. Zu jener Zeit war in London ein Festival deutscher Musik, da wurde Haydn gespielt. Das wurde abgesetzt, und es dauerte vierzehn Tage, bis die Englaender ueberzeugt waren, die Deutschen seien das barbarischste Volk der Welt, das die eigenen Kinder auffrisst. Ein Zweig der Familie meines Vaters lebte in Manchester. Es waren juedische Textilindustrielle. Nach dem Krieg haben sie den Verkehr mit der Familie Parin, die damals in der Suedsteiermark - im spaeteren Slowenien - gelebt hat, abgebrochen, weil mein Vater im Krieg drei Jahre einen Hilfszug - des Roten Kreuzes! - geleitet hat. Er gehoerte damit fuer diese vielleicht nicht sehr kultivierten, aber reich und vornehm gewordenen Englaender dauerhaft einer barbarischen Nation an. Format: Die Ereignisse auf dem Balkan waren viel drastischer. Parin: Es wurde nach dem Zusammenbruch des Tito-Sozialismus ueblich, das auf balkanische Barbarei zurueckzufuehren. Diese Argumentation spricht eine ethnologische Note an. Jeder Krieg bekommt eine gewisse Faerbung, einen gewissen Stil. Der schlimmste Krieg, naemlich der deutsche gegen die Juden, hatte eine buerokratische Tendenz. Die US-Kriege seit 1945 stehen ganz unter dem Primat fortschrittlichster Technik, bis der Krieg sich so veraendert hat, dass heute eine Armee kaempfen kann, ohne einen Verlust zu erleiden. Im nahoestlichen Raum verleiht der Machismus der Mittelmeerlaender den Kriegen haeufig eine grausam-sadistische Faerbung. Soweit kann die Ethnologie gehen: zu sagen, dass in diesen Gegenden, auch auf dem Balkan, individuell sadistische Emotionen leichter von kriegfuehrenden Parteien bewegt werden koennen. Format: Gab es unter Tito eine kulturelle Einheit? Dubravka Ugresic schreibt, Jugoslawiens Kultur bestand aus sozialistischen Schulbuechern und Hollywoodfilmen. Parin: Im Tito-Sozialismus haben verschiedene Kulturen zusammengelebt. Zwei waren hervorstechend. Die eine war die muselmanische bosnische Kultur, die im europaeischen Sinn viel zivilisierter war als die Serben und Montenegriner. Daneben gab es die Kroaten aus Dalmatien, die pflegten Sitten und Gebraeuche wie in Mittelitalien. Als Freiwilliger bei Titos Partisanen im Zweiten Weltkrieg wurde ich haeufig in requirierten Zimmern untergebracht. In einem Dorf mit muselmanischen Bosniern wurde ein Nachtessenstisch gedeckt, auch wenn nichts zu essen da war. Dann gab es eben ein Stueck Brotrinde auf einem Teller und dazu eine europaeische Konversation. Ich kann mich an einige Themen erinnern - das war fast vier Jahre nach der Besetzung Jugoslawiens! Es ging darum, ob heute in Deutschland noch Beethoven gespielt werde. Das alles in Bauerndoerfern in den montenegrinischen Bergen. Format: Handke idealisiert heute die Serben. Parin: Er beschreibt die Kriegswirtschaft in Serbien als agrarische Idylle und sieht darueber hinweg, dass hier ein Land einfach wirtschaftlich am Boden liegt. Als politischer Kritiker ist er gar nicht ernst zu nehmen. Viele Leute, die in exotische Laender gefahren sind, sind mit ihrem Bild dieses Exotismus zurueckgekommen und haben dieses Bild beschrieben. Handke konnte ja nur wenig Slowenisch, als er vom neunten Land zu traeumen begann. Ein klassisches Beispiel ist Joseph Conrad: Ein Englaender katholisch-polnischer Herkunft beschreibt Afrika als Herz der Finsternis. Im uebrigen hat der Verlag Suhrkamp die Sache auch durchaus betrieben. Siegfried Unseld hat die ungewoehnlichen Phantasien seines Dichters bewusst zu einem Skandal stilisiert. Ich hatte den Eindruck, als Handke nach Paris uebersiedelte, ist er in der literarischen und philosophischen Szene dort nie angekommen. Dort war man gegen das nationalistische Serbien. Da war Handke aus Trotz auf der anderen Seite. Format: Womit beschaeftigen Sie sich persoenlich zur Zeit am liebsten? Parin: Erzaehlungen schreiben. Aber seit Goldy, meine Frau, gestorben ist, mit der ich immer gemeinsam geschrieben habe, habe ich Probleme, auf die zahlreichen Erinnerungen erzaehlerisch richtig einzugehen. Die Phantasie leidet durch den Schmerz dieses Verlustes. Ich habe mich immer von ihrer Freude anstecken lassen, obzwar ich selbst kein Muffel war, aber halt ein bisschen ein Skeptiker. Format: Gelegentliche Schwermut bekaempfen Sie angeblich mit Heroin. Parin: Ach wo. Ich habe einen Artikel geschrieben ueber weise Pharmagreise, weil ich es als Arzt falsch fand, dass die wirksamsten Mittel den alten leidenden Menschen vorenthalten werden. Das sind eben haeufig Opiate. Ich kann der christlichen Idee, dass Leiden gut sei, nichts abgewinnen. Deswegen sollte man Substanzen, die das Leid mindern, anwenden. Das mag bei einem Depressiven ein wenig Heroin sein, bei einem afrikanischen Greis ein Hirsebier. Bei einer alten Frau vom afrikanischen Stamm der Agni, die wir Anna Freud nannten, weil sie der Freud-Tochter so aehnlich sah, war es Coca-Cola. Das richtige allerdings, kein Diaet-Coke. Ich meide nur Substanzen, die mir das Denken verunmoeglichen. Bild: Die Englaender glaubten, dass die Deutschen ihre eigenen Kinder auffressen. Bild: Handke ist in der Pariser literarischen und philosophischen Szene nie angekommen. Datenbank FORDB Dokumentennummer: FORMATDB_199907121911000071 *=MLMSFORMATDB_199907121911000071 Top of Form Favoriten: Bottom of Form
Format 35/99 vom 30.8.1999 Seite 142Ressort: FEU Feuilleton Interview: Gegen den medialen Morast Peter Turrini ueber seine neuen Theaterprojekte, Peter Handkes andere Kriegsberichte, Claus Peymanns Treue und Peter Pilz Courage: Fuer ihn wuerde ich in den Haefen gehen. Interview: Wolfgang Huber-Lang Format: Herr Turrini, dieser Tage erscheint eine dreibaendige Werkausgabe mit einer umfangreichen Materialsammlung. Wird sich das Turrini-Bild der OEffentlichkeit veraendern? Turrini: Das ist schwer zu sagen. Ich bin noch ganz erschoepft von der Arbeit daran, denn ich habe bis vor 14 Tagen an allen Stuecken herumgefummelt. Es ist ein komisches Gefuehl, wenn alles, was du in dreissig Jahren gemacht hast, in drei Baenden zusammengefasst wird. Eines sollte klar werden: dass alle meine AEusserungen, selbst Interviews oder Reden, mit Stuecken verknuepft sind. Der Kern meines Tuns ist ein theatralischer. Format: Diesen Eindruck bekam jeder, der Sie schon einmal auf einer Buehne gesehen hat. Turrini: Vielleicht bin ich gar kein Schriftsteller, sondern ein verkappter Schauspieler, der sich nur aus Mangel an Auftrittsmoeglichkeiten ununterbrochen Figuren erfindet. Alles an mir ist theatralisiert, sogar die privaten Briefe. An mir ist kein echtes Wort. Insofern ist alles wahr. Format: Erfinden Sie Ihre Rollen, um sich selbst auf die Schliche zu kommen oder um genau das zu vermeiden? Turrini: Ich habe das Gefuehl, dass ich im Spielerischen, Erfundenen die Wahrheit leichter finden kann. Im Gegensatz zum Theater, das seinen Schwindel eingesteht, geben die Medien staendig vor, wirklich zu sein. Dabei ueberfaellt mich aber zunehmend ein Gefuehl des Schwindels. Den Bildern des Vietnamkrieges bin ich noch mit aufrichtigem Zittern gefolgt, waehrend ich die Bilder aus dem Kosovo mit zunehmender Gleichgueltigkeit verfolge. Format: Heisst das: Rueckzug ins Private? Turrini: Ich moechte nicht in Abstumpfung oder politischer Distanz versinken, was ich sehr wohl als Gefahr sehe, aber ich moechte in diesem Morast aus medialen Luegen und Halbwahrheiten einen Boden unter den Fuessen finden. Ich versuche neue Blicke zu entwickeln. Ich fand die Art, wie Peter Handke vom Krieg berichtet hat, deshalb so bemerkenswert, weil er versuchte, abseits der gaengigen Kriegsbilder etwas anderes in die Debatte einzubringen: eine Flussbeschreibung, eine Wanderung. Fuer Naturbetrachtungen eigne ich mich nicht, aber auch mir geht es um den Versuch neuer Blicke. Ich bin frueher immer davon ausgegangen, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Damit habe ich Schiffbruch erlitten. Zunehmend denke ich, dass der Schein unser Bewusstsein bestimmt. Nicht, was ist, sondern das, was wir uns vorstellen, einbilden, bestimmt unser Leben. Format: Es faellt auf, dass Sie sich in letzter Zeit mit oeffentlichen AEusserungen zurueckhalten. Turrini: Seit ich das Gefuehl habe, mit jeder oeffentlichen Wortmeldung noch weiter in diesem medialen Brei zu versinken, versuche ich alles in der Literatur auszudruekken. Ich habe in den letzten Jahren unendlich viel mehr geschrieben als in den zwanzig Jahren vorher. Format: Ist das nicht jenes Kuenstlerbild, das viele wuenschen: sich auf seine Arbeit konzentrieren und aus der Auseinandersetzung raushalten? Turrini: Wer sagt denn, dass eine oeffentliche Debatte stattfindet, nur weil ein oesterreichischer Schriftsteller, wenn eine Redaktion anruft, wie ein Pawlowscher Hund zu bellen beginnt? Mich interessiert diese Art von Gegenwartsgebell, von dessen Wirksamkeit ich immer weniger ueberzeugt bin, nicht mehr. Ausserdem ist es auffallend, wie sehr die Geschwindigkeit dabei zunimmt und wie rasch dieses Gebell wieder verhallt. Heute rufen alle an und wollen Aussagen zur Sonnenfinsternis, morgen dann zum Lkw-Stau. Ich halte Zeitungen fuer einen Austragungsort von Geraeuschen, nicht von Inhal-ten. Aber selbst wenn ich mir wuenschte, weiter an dieser Art von Auseinandersetzung teilzunehmen - ich kann es einfach nicht mehr, weil es mir sonst die Kraft zum Schreiben ruiniert. Format: Ist das vorstellbar: Joerg Haider wird Bundeskanzler, und Peter Turrini macht nichts anderes, als ein Theaterstueck zu schreiben? Turrini: Das waere tatsaechlich das einzige, was ich tun koennte. Ich werde bestimmt nicht einer Einladung des FORMAT folgen und einen der zahlreichen dann faelligen, auf Knopfdruck bestellten Anti-Haider-Artikel schreiben. Das interessiert mich nicht. Ich weiss, dass das laecherlich, hagestolz und etwas groessenwahnsinnig ist, aber nehmen Sie mir ab, dass ich nicht gleichgueltiger geworden bin. Welche Zeitbomben der Seele in unserer Gesellschaft ticken, interessiert mich unendlich mehr als jede Staatssekretaersfrage. Format: Gilt das auch fuer die kommende Nationalratswahl? Turrini: Von allem Vorwahlgetoese ist mir nur etwas nahegekommen: der Mut des Peter Pilz und die Tatsache, dass er ploetzlich fuer das, was er ueber die Baukartelle sagt, eine 100-Millionen-Schilling-Klage am Hals hat. Das hat mich erreicht. Ich werde mich also ueberhaupt nicht dichterisch entrueckt aus allem Wahlgemetzel heraushalten, sondern mich nachhaltig fuer den Peter Pilz einsetzen. Format: Helmut Zenker und Alfred Hrdlicka steigen selbst in den Ring. Hat man auch versucht, Sie als Kandidaten zu gewinnen? Turrini: Alle rufen an, das ist ein Ritual. Aber den Pilz habe ich angerufen und ihm gesagt: Ich wuerde fuer dich in den Haefen gehen. Dann kann ich naemlich auch mein neues Stueck in Ruhe fertigschreiben. Format: Ihr Stueck Josef und Maria, das Sie derzeit am Theater in der Josefstadt inszenieren, ist knapp zwanzig Jahre alt und wurde von Ihnen ganz neu bearbeitet. Ist die Halbwertszeit Ihrer Stuecke so kurz? Turrini: Sie ist sehr unterschiedlich. Bei Rozznjogd habe ich den Regisseuren gleich von Anfang an vorgeschlagen, den Schluss selbst zu veraendern, bei Alpengluehen waere mir diese Vorstellung sehr unangenehm. Josef und Maria hielt ich beim Wiederlesen fuer ein Stueck, in dem etwas Entscheidendes zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt passiert: Das Stueck spielt jetzt am 24. Dezember 1991, also buchstaeblich am Vorabend des Untergangs der Sowjetunion. An diesem Tag hat der alte Kommunist Josef noch eine Spur recht, am naechsten Tag ist er schon der Narr der Geschichte. Aufgrund dieser zeitlichen Verschiebung musste ich einiges aendern. Und ich habe mir beim Umschreiben vorgenommen, mich nicht mehr ueber den Wahn der Menschen lustig zu machen, ueber ihre laecherlichen Sehnsuechte und Obsessionen. Denn die bestimmen in Wahrheit unser Leben. Format: Ihr eigenes Leben wird zunehmend vom Theater bestimmt. Neuerdings schreiben Sie auch Opernlibretti, sogar fuer die Staatsoper. Und erstmals fuehren Sie auch selbst Regie. Turrini: Das alles und die Tatsache, dass ich mir schon beim Schreiben meine eigenen Figuren vorspiele, ist so laecherlich und naerrisch, dass es nur im Dunkeln stattfinden kann, im Dunkel des Theaters. Ich bin Teil meines grotesken Figurenpersonals, stehe in der Reihe meiner Narren und winke mit der Theaterfahne. Aber ich hatte das Glueck, in den letzten 13 Jahren einem aehnlichen Narren, einem aehnlich lebensunfaehigen Menschen begegnet zu sein, naemlich Claus Peymann. Format: Von ihm haben Sie sich auf der Buehne des Akademietheaters sehr persoenlich verabschiedet. Gehen Sie im Geiste mit ihm? Turrini: Ich moechte ein Stueck fuer das Berliner Ensemble schreiben, und wir haben das fuer die naechste Spielzeit auch grundsaetzlich vereinbart. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein verpflanzbarer Dichter bin, aber ich wuerde die Treue, die er mir ueber 13 Jahre gehalten hat, ueber gute und schlechte Stuecke hinweg, gerne erwidern. Format: Mit Ihrem neuen Stueck Kasino sind Sie aber zu Klaus Bachler fremdgegangen. Turrini: Das ist keine Untreue. Ich kann ja auch den Peymann nicht dazu vergattern, nur noch meine Stuecke zu spielen - obwohl ich das gerne taete. Bachler hat vorgeschlagen, etwas zu Silvester zu machen. Ich wollte schon immer etwas ueber die oesterreichische Geschichte erzaehlen, auch ueber den Austrofaschismus. Und ich wollte eine neue Form ausprobieren. Seit einer Woche ist das Stueck fertig. Es ist ein Tanzspiel geworden, mit wenig gesprochenen Worten, nur zwei Seiten Sprechtext. Format: Ein Turrini-Ballett? Turrini: Ja. Wenn ich den Mut haette, wuerde ich Ihnen das jetzt vorspringen. Aber ich fuerchte, dann wuerde ich mich endgueltig laecherlich machen. Peter Turrini: Neue Buecher und Stuecke Eine dreibaendige Werkausgabe ist soeben bei Luchterhand erschienen (je oeS 321,-). Gerd Kuehrs Oper Tod und Teufel, nach Turrinis Libretto, wird am 17. 9. in Graz uraufgefuehrt. Am 7. 10. folgt in der Josefstadt Turrinis erste Regiearbeit, Josef und Maria, mit Otto Schenk und Christine Ostermayer. Im Dezember wird schliesslich Kasino - Ein Tanzspiel im Burgtheater-Kasino uraufgefuehrt. Vorabdruck Das Turrini-Ballett Szenen aus dem neuen StueckKasino - Ein Tanzspiel. 60. Das kleine Maedchen: Mozart brennt, und wir gehen auf Reisen. Aus der Tonanlage hoert man die Einleitungsmusik einer Sondermeldung im Dritten Reich. Stimme des Radiosprechers: Am 29. November 1941 veranstaltet die Wiener NS-Parteileitung eine Gedenkfeier fuer Wolfgang Amadeus Mozart, anlaesslich seines 150. Todestages. Mit der naturgetreuen Nachbildung des Komponisten wurden der Zuckerbaecker und Amateurkuenstler Hans Stoixner und seine Frau Anna aus Pressbaum beauftragt. 61. Im Tanzsaal wird es feuerhell. Zwischen den Saeulen des Tanzsaales sind Blechrinnen angebracht, in ihnen rinnt ein kleiner Benzinbach, und aus ihnen lodern Flammen. Der Tod versucht, den Stahlhelm vom Kopf zu kriegen, es geht einfach nicht. Das Zukkerbaecker-Ehepaar Stoixner schiebt eine lebensgrosse Figur aus Butter, Wolfgang Amadeus Mozart darstellend, in die Mitte des Tanzsaales. Rundherum lodert das Feuer. 62. Aus den Separees kommen die Taenzerinnen und Taenzer und formieren sich zu einem Marsch. Sie haben Wanderkleidung der 30er und 40er Jahre an, Bergschuhe, weisse Stutzen, Lederhosen oder Knickerbocker, Hemden, Anoraks und Wanderhuete. Sie marschieren im Gaensemarsch um die Rinnen herum und singen ein Wanderlied. Das Ehepaar Hans und Anna Stoixner reiht sich ein und marschiert und singt mit. Der Butter-Mozart beginnt zu schmelzen. 63. Der Himmel ist voll leuchtender Sterne, Judensterne. Die Wanderer pfluecken sie und werfen sie in das Feuer, welches aus den Rinnen lodert. Es stinkt nach verbranntem Stoff. Wolfgang Amadeus Mozart ist nicht mehr zu erkennen. Der Tod versucht den Stahlhelm vom Kopf zu bekommen, es gelingt ihm nicht. Seine Musiker helfen ihm dabei, vergebens. 64. Die Wanderer marschieren und singen. Sie waten in zerlassener Butter. Aus der Tonanlage droehnt Fliegeralarm. Die Wanderer werfen sich zu Boden und kauern sich zusammen. Man hoert Bomben fallen. Alle kommen um, ausser dem Ehepaar Stoixner. Die beiden liegen zwischen Leichen, beginnen zu kopulieren und kommen bruellend zum Hoehepunkt. Sie kriechen unter dem Leichenberg hervor, durch zerlassene Butter am Boden des Tanzsaales dahin, jeder in eine andere Richtung. Datenbank FORDB Dokumentennummer: FORMATDB_199908301831000070 *=MLMSFORMATDB_199908301831000070
Dokument 2 von 2
|
|